 |
 |
|||

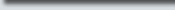
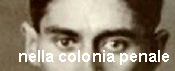
"Ein junger Student…" (II, 14)
Ein junger Student wollte an einem Abend im Januar zur Zeit der großen Gesellschaften seinen besten Freund, den Sohn eines hohen Staatsbeamten aufsuchen. Er wollte ihm ein Buch zeigen, das er gerade las und von dem er ihm auch schon viel erzählt hatte. Es war ein schwer verständliches Buch über die Grundzüge der Geschichte der Volkswirtschaft, man konnte nur schwer folgen, der Autor hielt sein Thema, wie es in einer Kritik sehr bezeichnend hieß, an sich gedrückt, wie der Vater das Kind mit dem er durch die Nacht reitet. Trotz aller Schwierigkeit verlockte es aber den Studenten sehr; wenn er eine zusammenhängende Stelle durchdrungen hatte, fühlte er einen großen Gewinn, nicht nur die gerade vorgetragene Ansicht, sondern alles ringsherum schien ihm einleuchtender, besser bewiesen und widerstandskräftiger. Einigemal auf dem Weg zu seinem Freund blieb er unter einer Laterne stehn und las bei dem durch Schneenebel gedämpften Licht einige Sätze. Große seine Fassungskraft übersteigende Sorgen bedrückten ihn, das Gegenwärtige war zu erfassen, die vor ihm liegende Aufgabe aber erschien ihm undeutlich und ohne Ende, vergleichbar nur seinen Kräften, die er ebenso und noch nicht aufgerufen in sich fühlte.
Das Schreiben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen. Nicht Biographie, sondern Untersuchung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile. Daraus will ich mich dann aufbauen so wie einer, dessen Haus unsicher ist, daneben ein sicheres aufbauen will, womöglich aus dem Material des alten. Schlimm ist es allerdings wenn mitten im Bau seine Kraft aufhört und er jetzt statt eines zwar unsichern aber doch vollständigen Hauses, ein halbzerstörtes und ein halbfertiges hat, also nichts. Was folgt ist Irrsinn, also etwa ein Kosakentanz zwischen den zwei Häusern, wobei der Kosak mit den Stiefelabsätzen die Erde solange scharrt und auswirft, bis sich unter ihm sein Grab bildet.
Die Leichtfertigkeit der Kinder ist unbegreiflich. Aus dem Fenster meines Zimmers sehe ich in einen kleinen öffentlichen Garten hinunter. Ein kleiner städtischer Garten ist es, nicht viel mehr als ein staubiger freier Platz, der von welken Gesträuchen gegen die Gasse hin abgegrenzt ist. Dort spielten die Kinder, wie immer, auch heute nachmittag.
"Wie bin ich hierhergekommen?" rief ich. Es war ein mäßig großer von mildem elektrischem Licht beleuchteter Saal, dessen Wände ich abschritt. Es waren zwar einige Türen vorhanden, öffnete man sie aber, dann stand man vor einer dunklen glatten Felswand, die kaum eine Handbreit von der Türschwelle entfernt war und geradlinig aufwärts und nach beiden Seiten in unabsehbare Ferne verlief. Hier war kein Ausweg. Nur eine Tür führte in ein Nebenzimmer, die Aussicht dort war hoffnungsreicher aber nicht weniger befremdend als bei den andern Türen. Man sah in ein Fürstenzimmer, Rot und Gold herrschte dort vor, es gab dort mehrere wandhohe Spiegel und einen großen Glasluster. Aber das war noch nicht alles.
Ich muß nicht mehr zurück, die Zelle ist gesprengt, ich bewege mich, ich fühle meinen Körper.
Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich gieng selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wußte nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: "Wohin reitest Du, Herr?" "Ich weiß es nicht", sagte ich, "nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen. " "Du kennst also Dein Ziel?" fragte er. "Ja", antwortete ich, "ich sagte es doch, >Weg-von-hier<, das ist mein Ziel." "Du hast keinen Eßvorrat mit", sagte er. "Ich brauche keinen", sagte ich, "die Reise ist so lang, daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise. "
F. (über Geschäftsbüchern) Sieh mal, nun also sieh mal –
Es klopft zweimal stark, dann noch einmal leiser
F. Ich komme –
Er geht langsam, schlurfend zur Tür, sieht durch das Guckloch, nickt, öffnet zwei Schlösser, dann die Tür.
T. (zarte alte Dame) Guten Tag, lieber Felix.
F. Es ist sehr lieb, Tante, daß Du gekommen bist.
T. Du schriebst mir doch, Felix, natürlich kam ich gleich.
F. Nun freilich, nun freilich.
Sie setzen sich
F. Du bist immer meine Beraterin gewesen.
T. Ich? Eine unwissende Frau. Immer machst Du den gleichen Scherz mit mir.
F. Es ist kein Scherz. Was wäre ich ohne Dich! Andererseits freilich –
T. Nun?
F. Andererseits freilich müßte ich mich, wenn Du nicht wärest, auch allein durch die Welt schlagen.
T. Nun also.
F. Nein, Tante, nicht so – ich bitte, verlaß mich nicht
Atemlos kam ich an. Eine Stange war ein wenig schief in den Boden gerammt und trug eine Tafel mit der Aufschrift "Versenkung". Ich dürfte am Ziel sein, sagte ich mir und blickte mich um. Nur paar Schritte weit war eine unscheinbare dicht mit Grün überwachsene Gartenlaube, aus der ich leichtes Tellerklappern hörte. Ich ging hin, steckte den Kopf durch die niedrige Öffnung, sah kaum etwas in dem dunklen Innern, grüßte aber doch und fragte: "Wissen Sie nicht wer die Versenkung besorgt?" "Ich selbst, Ihnen zu dienen", sagte eine freundliche Stimme, "ich komme sofort. " Nun erkannte ich langsam die kleine Gesellschaft, es war ein junges Ehepaar, drei kleine Kinder, die mit der Stirn kaum die Tischplatte erreichten und ein Säugling, noch in den Armen der Mutter. Der Mann der in der Tiefe der Laube saß wollte gleich aufstehn und sich hinausdrängen, die Frau aber bat ihn herzlich, zuerst das Essen zu beenden, er jedoch zeigte auf mich, sie wiederum sagte, ich werde so freundlich sein und ein wenig warten und ihnen die Ehre erweisen, an ihrem armen Mittagessen teilzunehmen, ich schließlich, äußerst ärgerlich über mich selbst, der ich hier die Sonntagsfreude so häßlich störte, mußte sagen: "Leider leider, liebe Frau, kann ich der Einladung nicht entsprechen, denn ich muß mich augenblicklich, ja wirklich augenblicklich versenken lassen. " "Ach", sagte die Frau, "gerade am Sonntag und noch beim Mittagessen. Ach die Launen der Leute. Die ewige Sklaverei.""ZankenSie doch nicht so",sagte ich,"ich verlange es ja von Ihrem Mann nicht aus Mutwillen und wüßte ich wie man es macht, hätte ich es schon längst allein getan. " "Hören Sie nicht auf die Frau", sagte der Mann, der schon neben mir war und mich fortzog. "Verlangen Sie doch nicht Verstand von Frauen.
Es war sehr unsicher, ob ich Fürsprecher hatte, ich konnte nichts Genaues darüber erfahren, alle Gesichter waren abweisend, die meisten Leute die mir entgegen kamen und die ich wieder und wieder auf den Gängen traf, sahen wie alte dicke Frauen aus, sie hatten große, den ganzen Körper bedeckende, dunkelblau und weiß gestreifte Schürzen, strichen sich den Bauch und drehten sich schwerfällig hin und her. Ich konnte nicht einmal erfahren, ob wir in einem Gerichtsgebäude waren. Manches sprach dafür, vieles dagegen. Über alle Einzelnheiten hinweg erinnerte mich am meisten an ein Gericht ein Dröhnen, das unaufhörlich aus der Ferne zu hören war, man konnte nicht sagen aus welcher Richtung es kam, es erfüllte so sehr alle Räume, daß man annehmen konnte, es komme von überall oder, was noch richtiger schien, gerade der Ort, wo man zufällig stand, sei der eigentliche Ort dieses Dröhnens, aber gewiß war das eine Täuschung, denn es kam aus der Ferne. Diese Gänge, schmal, einfach überwölbt, in langsamen Wendungen geführt, mit sparsam geschmückten hohen Türen, schienen sogar für tiefe Stille geschaffen, es waren die Gänge eines Museums oder einer Bibliotek. Wenn es aber kein Gericht war, warum forschte ich dann hier nach einem Fürsprecher? Weil ich überall einen Fürsprecher suchte, überall ist er nötig, ja man braucht ihn weniger bei Gericht als anderswo, denn das Gericht spricht sein Urteil nach dem Gesetz, sollte man annehmen, daß es hiebei ungerecht oder leichtfertig vorgehe, wäre ja kein Leben möglich, man muß zum Gericht das Zutrauen haben, daß es der Majestät des Gesetzes freien Raum gibt, denn das ist seine einzige Aufgabe, im Gesetz selbst aber ist alles Anklage, Fürspruch und Urteil, das selbstständige Sicheinmischen eines Menschen hier wäre Frevel. Anders aber verhält es sich mit dem Tatbestand eines Urteils, dieser gründet sich auf Erhebungen, auf Erhebungen hier und dort, bei Verwandten und Fremden, bei Freunden und Feinden, in der Familie und in der Öffentlichkeit, in Stadt und Dorf, kurz überall. Hier ist es dringendst nötig Fürsprecher zu haben, Fürsprecher in Mengen, am besten Fürsprecher, einer eng neben dem andern, eine lebende Mauer, denn die Fürsprecher sind ihrer Natur nach schwer beweglich, die Ankläger aber, diese schlauen Füchse, diese flinken Wiesel, diese unsichtbaren Mäuschen schlüpfen durch die kleinsten Lücken, huschen zwischen den Beinen der Fürsprecher durch. Also Achtung! Deshalb bin ich ja hier, ich sammle Fürsprecher. Aber ich habe noch keinen gefunden, nur diese alten Frauen kommen und gehn, immer wieder, wäre ich nicht auf der Suche, es würde mich einschläfern. Ich bin nicht am richtigen Ort, leider kann ich mich dem Eindruck nicht verschließen, daß ich nicht am richtigen Ort bin. Ich müßte an einem Ort sein, wo vielerlei Menschen zusammenkommen, aus verschiedenen Gegenden, aus allen Ständen, aus allen Berufen, verschiedenen Alters, ich müßte die Möglichkeit haben die Tauglichen, die Freundlichen, die, welche einen Blick für mich haben vorsichtig auszuwählen aus einer Menge. Am besten wäre dazu vielleicht ein großer Jahrmarkt geeignet. Statt dessen treibe ich mich auf diesen Gängen umher, wo nur diese alten Frauen zu sehn sind und auch von ihnen nicht viele und immerfort die gleichen und selbst diese wenigen trotz ihrer Langsamkeit lassen sich von mir nicht stellen, entgleiten mir, schweben wie Regenwolken, sind von unbekannten Beschäftigungen ganz in Anspruch genommen. Warum eile ich denn blindlings in ein Haus, lese nicht die Aufschrift über dem Tor, bin gleich auf den Gängen, setze mich hier mit solcher Verbohrtheit fest, daß ich mich gar nicht erinnern kann, jemals vor dem Haus gewesen, jemals die Treppen hinaufgelaufen zu sein. Zurück aber darf ich nicht, diese Zeitversäumnis, dieses Eingestehn eines Irrwegs wäre mir unerträglich. Wie? In diesem kurzen, eiligen, von einem ungeduldigen Dröhnen begleiteten Leben eine Treppe hinunterlaufen? Das ist unmöglich. Die Dir zugemessene Zeit ist so kurz, daß Du, wenn Du eine Sekunde verlierst, schon Dein ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht länger; es ist immer nur so lang wie die Zeit, die Du verlierst. Hast Du also einen Weg begonnen, setze ihn fort, unter allen Umständen, Du kannst nur gewinnen, Du läufst keine Gefahr, vielleicht wirst Du am Ende abstürzen, hättest Du aber schon nach den ersten Schritten Dich zurückgewendet und wärest die Treppe hinuntergelaufen, wärest Du gleich am Anfang abgestürzt und nicht vielleicht sondern ganz gewiß. Findest Du also nichts hier auf den Gängen, öffne die Türen, findest Du nichts hinter diesen Türen, gibt es neue Stockwerke, findest Du oben nichts, es ist keine Not, schwinge Dich neue Treppen hinauf, solange Du nicht zu steigen aufhörst, hören die Stufen nicht auf, unter Deinen steigenden Füßen, wachsen sie aufwärts.
Es war ein schmaler, niedriger, rundgewölbter, weiß getünchter Gang, ich stand vor seinem Eingang, er führte schief in die Tiefe. Ich wußte nicht, ob ich eintreten sollte, unschlüssig zerrieb ich mit meinen Füßen das schüttere Gras, das vor dem Eingang wuchs. Da kam ein Herr vorüber, wohl zufällig, er war ein wenig gebückt, aber willkürlich, weil er mit mir sprechen wollte. "Wohin denn Kleiner?" fragte er. "Noch nirgendhin", sagte ich und blickte in sein fröhliches, aber hochmütiges Gesicht – es wäre hochmütig gewesen auch ohne das Monokle, das er trug – "noch nirgendhin. Ich überlege erst. "
"Sonderbar!" sagte der Hund und strich sich mit der Hand über die Stirn. "Wo bin ich denn herumgelaufen, zuerst über den Marktplatz, dann durch den Hohlweg den Hügel hinauf, dann vielemal über die große Hochebene kreuz und quer, dann den Absturz hinunter, dann ein Stück auf der Landstraße, dann links zum Bach, dann die Pappelreihe entlang, dann an der Kirche vorbei und jetzt bin ich hier. Warum denn das? Und ich war dabei verzweifelt. Ein Glück, daß ich wieder zurück bin. Ich fürchte mich vor diesem zwecklosen Herumlaufen, vor diesen großen öden Räumen, was für ein armer, hilfloser, kleiner, gar nicht mehr aufzufindender Hund bin ich dort. Es lockt mich auch gar nichts dazu von hier wegzulaufen, hier im Hof ist mein Ort, hier ist meine Hütte, hier meine Kette für den manchmal eintretenden Fall der Bissigkeit, alles ist hier und reichliche Nahrung. Nun also. Ich würde auch niemals aus eigenem Willen von hier weglaufen, ich fühle mich hier wohl, bin stolz auf meine Stellung, wohlige aber berechtigte Überhebung durchrieselt mich beim Anblick des anderen Viehs. Lauft aber irgendein anderes von den Tieren so sinnlos weg wie ich? Kein einziges, die Katze, das weiche krallige Ding, die niemand benötigt und niemand entbehrt, nehme ich aus, sie hat ihre Geheimnisse die mich nicht kümmern und lauft in ihrem Dienst herum, aber auch sie nur im Bezirk des Hauses. Ich bin also der einzige, der hie und da desertiert, und es kann mich ganz gewiß einmal meine überragende Stellung kosten. Heute scheint es glücklicherweise niemand bemerkt zu haben, aber letzthin machte schon Richard, der Sohn des Herrn, eine Bemerkung darüber. Es war Sonntag, Richard saß auf der Bank und rauchte, ich lag zu seinen Füßen, die Wange an die Erde gedrückt. "Cäsar", sagte er, "Du böser untreuer Hund, wo warst Du heute morgens? Um fünf Uhr früh, also zu einer Zeit, wo Du noch wachen sollst, habe ich Dich gesucht und Dich nirgends im Hof gefunden, erst um viertel sieben bist Du zurückgekommen. Das ist eine Pflichtverletzung sondergleichen, weißt Du das?" So war es also wieder einmal entdeckt. Ich stand auf, setzte mich zu ihm, umfaßte ihn mit einem Arm und sagte: "Lieber Richard, sieh es mir dieses eine Mal noch nach und verbreite die Sache nicht. Soweit es an mir liegt, es soll nicht wieder vorkommen. " Und ich weinte so sehr, aus allen möglichen Gründen, aus Verzweiflung über mich, aus Angst vor Strafe, aus Rührung über Richards friedliche Miene, aus Freude über das augenblickliche Fehlen eines Strafwerkzeugs, ich weinte so sehr, daß ich mit meinen Tränen Richards Rock näßte, er mich abschüttelte und mir befahl mich zu kuschen. Damals versprach ich also Besserung und heute wiederholt sich das Gleiche, ich war sogar länger fort als damals. Freilich, ich versprach nur mich zu bessern, soweit es an mir liegt. Und es ist nicht meine Schuld
Der Kampf mit der Zellenwand
Unentschieden
Es ist eine schöne und wirkungsvolle Vorführung, der Ritt den wir den Ritt der Träume nennen. Wir zeigen ihn schon seit Jahren, der welcher ihn erfunden hat, ist längst gestorben, an Lungenschwindsucht, aber diese seine Hinterlassenschaft ist geblieben und wir haben noch immer keinen Grund den Ritt von den Programmen abzusetzen, umsoweniger, als er von der Konkurrenz nicht nachgeahmt werden kann, er ist, trotzdem das auf den ersten Blick nicht verständlich ist, unnachahmbar. Wir pflegen ihn an den Schluß der ersten Abteilung zu setzen, als Abschluß des Abends würde er sich nicht eignen, es ist nichts Blendendes, nichts Kostbares, nichts wovon man auf dem Nachhauseweg spricht, zum Schluß muß etwas kommen, was auch dem gröbsten Kopf unvergeßlich bleibt, etwas was den ganzen Abend vor dem Vergessenwerden rettet, etwas derartiges ist dieser Ritt nicht, wohl aber ist er geeignet
Es sind zwei Schwestern, eine
In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnte, solche Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler, von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme, jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehn, an den späteren Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen, auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt, zur Erhöhung der Wirkung bei Fackelschein, an schönen Tagen wurde der Käfig ins Freie getragen und nun waren es besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wurde, während er für die Erwachsenen oft nur ein Spaß war, an dem sie der Mode halber teilnahmen, sahen die Kinder staunend, mit offenem Mund, der Sicherheit halber einander bei der Hand haltend dem Hungerkünstler zu, wie er bleich, im schwarzen Trikot, mit mächtig vortretenden Rippen, sogar einen Sessel verschmähend, auf hingestreutem Stroh saß, einmal höflich nickend, angestrengt lächelnd Fragen beantwortete, auch durch das Gitter den Arm streckte, um seine Magerkeit befühlen zu lassen, dann aber wieder ganz in sich selbst versank, um niemanden sich kümmerte, nicht einmal um den für ihn so wichtigen Schlag der Uhr, die das einzige Möbelstück des Käfigs war, sondern nur vor sich hinsah mit fast geschlossenen Augen und hie und da aus einem winzigen Gläschen Wasser nippte, um sich die Lippen zu feuchten. Außer den wechselnden Zuschauern waren auch ständige vom Publikum gewählte Wächter da, merkwürdiger Weise gewöhnlich Fleischhauer, welche, immer drei gleichzeitig, die Aufgabe hatten Tag und Nacht den Hungerkünstler zu beobachten, damit er nicht etwa auf irgendeine heimliche Weise doch Nahrung zu sich nehme. Es war das aber lediglich eine Formalität, eingeführt zur Beruhigung der Massen, denn die Eingeweihten wußten wohl, daß der Hungerkünstler während der Hungerzeit niemals, unter keinen Umständen, selbst unter Zwang nicht, auch das Geringste nur gegessen hätte; die Ehre seiner Kunst verbot dies. Freilich, nicht jeder Wächter konnte das begreifen, es fanden sich manchmal nächtliche Wachgruppen, welche die Bewachung sehr lax durchführten, absichtlich in eine ferne Ecke sich zusammensetzten und dort sich ins Kartenspiel vertieften in der offenbaren Absicht, dem Hungerkünstler eine kleine Erfrischung zu gönnen, die er ihrer Meinung nach aus irgendwelchen geheimen Vorräten hervorholen konnte. Nichts war dem Hungerkünstler quälender als solche Wächter, sie machten ihn trübselig, sie machten ihm das Hungern entsetzlich schwer, manchmal überwand er seine Schwäche und sang während dieser Wachtzeit, solange er es nur aushielt, um den Leuten zu zeigen, wie ungerecht sie ihn verdächtigten. Doch half das wenig, sie wunderten sich dann nur über seine Geschicklichkeit, selbst während des Singens zu essen. Viel lieber waren ihm die Wächter, welche sich eng zum Gitter setzten, mit der trüben Nachtbeleuchtung des Saales sich nicht begnügten sondern ihn mit den elektrischen Taschenlampen bestrahlten, die ihnen der Impresario zur Verfügung stellte. Das grelle Licht störte ihn gar nicht, schlafen konnte er ja überhaupt nicht und ein wenig hindämmern konnte er immer, bei jeder Beleuchtung und zu jeder Stunde, auch im übervollen lärmenden Saal. Er war sehr gern bereit mit solchen Wächtern die Nacht gänzlich ohne Schlaf zu verbringen, er war bereit mit ihnen zu scherzen, ihnen Geschichten aus seinem Wanderleben zu erzählen, dann wieder ihre Erzählungen anzuhören, alles nur um sie wachzuhalten, um ihnen immer wieder zeigen zu können, daß er nichts Eßbares im Käfig hatte und daß er hungerte wie keiner von ihnen es könnte. Am glücklichsten aber war er wenn dann der Morgen kam und ihnen auf seine Rechnung ein überreiches Frühstück gebracht wurde, auf das sie sich warfen mit dem Appetit gesunder Männer nach einer mühevoll durchwachten Nacht. Es gab zwar sogar Leute, die in diesem Frühstück eine ungebürliche Beeinflussung der Wächter sehen wollten, aber das ging doch zu weit, und wenn man sie fragte, ob etwa sie nur um der Sache willen ohne Frühstück die Nachtwache übernehmen wollten, verzogen sie sich, aber bei ihren Verdächtigungen blieben sie dennoch. Dieses allerdings gehörte schon zu den unvermeidlichen vom Hungern überhaupt nicht zu trennenden Verdächtigungen. Niemand war ja imstande alle die Tage und Nächte beim Hungerkünstler ununterbrochen als Wächter zu verbringen, niemand also konnte aus eigener Anschauung wissen ob wirklich ununterbrochen, fehlerlos gehungert worden war. Nur der Hungerkünstler selbst konnte das wissen, nur er also gleichzeitig der von seinem Hungern vollkommen befriedigte Zuschauer sein. Er allerdings war wieder aus einem andern Grunde niemals befriedigt, vielleicht war er gar nicht vom Hungern so sehr abgemagert, daß manche zu ihrem Bedauern den Vorführungen fernbleiben mußten, weil sie seinen Anblick nicht ertrugen, sondern er war nur so abgemagert aus Unzufriedenheit mit sich selbst. Er allein nämlich wußte, auch kein Eingeweihter sonst wußte das, wie leicht das Hungern war. Es war die leichteste Sache von der Welt. Er verschwieg es auch nicht, aber man glaubte ihm nicht, sondern hielt ihn im günstigsten Fall für bescheiden, meist aber für reklamesüchtig oder gar für einen Schwindler, dem das Hungern allerdings leicht war, weil er es sich leicht zu machen verstand, und der auch noch die Stirn hatte, es halb zu gestehn. Das alles mußte er hinnehmen, hatte sich auch im Lauf der Jahre daran gewöhnt und errötete längst nicht mehr wie es ihm früher regelmäßig geschehen war, wenn man mit ihm über das Hungern sprach. Aber innerlich nagte diese Unbefriedigtheit immer an ihm und noch niemals, nach keiner Hungerperiode – dieses Zeugnis mußte man ihm ausstellen – hatte er freiwillig den Käfig verlassen. Als Höchstzeit für das Hungern hatte der Impresario vierzig Tage festgesetzt, darüber hinaus ließ er den Künstler niemals hungern, auch in den Weltstädten nicht, undzwar aus gutem Grund. Vierzig Tage etwa konnte man erfahrungsgemäß durch allmählich sich steigernde Reklame das Interesse einer Stadt immer mehr aufstacheln, dann aber versagte das Publikum, eine wesentliche Abnahme des Zuspruchs war festzustellen; es bestanden natürlich in dieser Hinsicht kleine Unterschiede zwischen den Städten und Ländern, als Regel aber galt, daß vierzig Tage die Höchstzeit war. Dann also am vierzigsten Tage wurde die Tür des mit Blumen umkränzten Käfigs geöffnet, eine begeisterte Zuschauerschaft erfüllte das Amphiteater, eine Militärkapelle spielte, zwei Ärzte betraten den Käfig um die nötigen Messungen am Künstler vorzunehmen, durch ein Megaphon wurden die Resultate dem Saale verkündet und schließlich kamen zwei junge Damen, glücklich darüber daß gerade sie ausgelost worden waren, und wollten den Hungerkünstler aus dem Käfig paar Stufen hinab führen, wo auf einem kleinen Tischchen eine sorgfältig ausgewählte Krankenmahlzeit serviert war. Und in diesem Augenblick wehrte sich der Hungerkünstler immer. Zwar legte er noch freiwillig seine Knochenarme in die hilfsbereit ausgestreckten Hände der zu ihm hinabgebeugten Damen, aber aufstehn wollte er nicht. Warum jetzt gerade nach vierzig Tagen aufhören, er hätte es noch lange, unbeschränkt lange ausgehalten, warum gerade jetzt aufhören, wo er im besten, ja noch nicht einmal im besten Hungern war. Warum wollte man ihn des Ruhmes berauben weiterzuhungern, nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden, der er ja wahrscheinlich schon war, aber auch noch sich selbst zu übertreffen bis ins Unbegreifliche, denn für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen. Warum hatte diese Menge, die ihn so sehr zu bewundern vorgab so wenig Geduld mit ihm; wenn er es aushielt noch weiter zu hungern, warum wollte sie es nicht aushalten? Auch war er müde, saß gut im Stroh und sollte sich nun hoch und lang aufrichten und zu dem Essen gehn, das ihm schon allein in der Vorstellung Übelkeiten verursachte, deren Äußerung er nur mit Rücksicht auf die Damen mühselig unterdrückte. Und er blickte empor in die Augen der scheinbar so freundlichen, in Wirklichkeit so grausamen Damen und schüttelte den auf dem schwachen Halse überschweren Kopf. Aber dann geschah, was immer geschah. Der Impresario kam, hob stumm – die Musik machte das Reden unmöglich – die Arme über dem Hungerkünstler, so als lade er den Himmel ein, sich sein Werk hier auf dem Stroh einmal anzusehn, diesen bedauernswerten Märtyrer, welcher der Hungerkünstler allerdings wirklich war, nur in ganz anderem Sinn, faßte den Hungerkünstler um die dünne Taille, wobei er durch übertriebene Vorsicht glaubhaft machen wollte, mit einem wie gebrechlichen Ding er es hier zu tun habe, und übergab ihn, nicht ohne ihn im Geheimen ein wenig zu schütteln, so daß der Hungerkünstler mit den Beinen und dem Oberkörper unbeherrscht hin und her schwankte, den inzwischen totenbleich gewordenen Damen. Nun duldete der Hungerkünstler alles, der Kopf lag auf der Brust, es war als sei er hingerollt und halte sich dort unerklärlich, der Leib war ausgehöhlt, die Beine drückten sich im Selbsterhaltungstrieb fest in den Knien aneinander, scharrten aber doch den Boden, so als sei es nicht der wirkliche, den wirklichen suchten sie erst; und die ganze, allerdings sehr kleine Last des Körpers lag auf einer der Damen, welche hilfesuchend, mit fliegendem Atem – so hatte sie sich dieses Ehrenamt nicht vorgestellt – zuerst den Hals möglichst streckte um wenigstens das Gesicht vor der Berührung mit dem Hungerkünstler zu bewahren, dann aber da ihr dies nicht gelang und ihre glücklichere Gefährtin ihr nicht zuhilfe kam, sondern sich damit begnügte zitternd die Hand des Hungerkünstlers, dieses kleine Knochenbündel, vor sich herzutragen, unter dem entzückten Gelächter des Saales in Weinen ausbrach und von einem längst bereit gestellten Diener abgelöst werden mußte. Dann kam das Essen, von dem der Impresario dem Hungerkünstler während eines ohnmachtähnlichen Halbschlafes ein wenig einflößte, unter lustigem Plaudern, das die Aufmerksamkeit vom Zustand des Hungerkünstlers ablenken sollte, dann wurde noch ein Trinkspruch auf das Publikum vorgebracht welcher dem Impresario vom Hungerkünstler angeblich zugeflüstert worden war, das Orchester bekräftigte alles durch einen großen Tusch, man ging auseinander und niemand hatte das Recht mit dem Gesehenen unzufrieden zu sein, niemand, nur der Hungerkünstler, immer nur er.
So lebte er mit regelmäßigen kleinen Ruhepausen viele Jahre, in scheinbarem Glanz, von der Welt geehrt, bei alledem aber meist in trüber Laune, die immer noch trüber wurde dadurch, daß sie niemand ernstzunehmen verstand. Womit sollte man ihn auch tröstend Was blieb ihm zu wünschen übrige Und wenn sich einmal ein Gutmütiger fand, der ihn bedauerte und ihm erklären wollte, daß seine Traurigkeit wahrscheinlich von dem Hungern käme, konnte es, besonders bei vorgeschrittener Hungerzeit, geschehn, daß der Hungerkünstler mit einem Wutausbruch antwortete und zum Schrecken aller wie ein Tier an dem Gitter zu rütteln begann. Doch hatte für solche Zustände der Impresario ein Strafmittel, das er gern anwandte. Er entschuldigte den Hungerkünstler vor versammeltem Publikum, gab zu, daß nur die durch das Hungern hervorgerufene, für satte Menschen nicht ohne weiters begreifliche Reizbarkeit das Benehmen des Hungerkünstlers verzeihlich machen könne, kam dann im Zusammenhang damit auch auf die ebenso zu erklärende Behauptung des Hungerkünstlers zu sprechen, er könnte noch viel länger hungern als er hungere, lobte das hohe Streben, den guten Willen, die große Selbstverläugnung, die gewiß auch in dieser Behauptung enthalten seien, suchte dann aber die Behauptung einfach genug durch Vorzeigen von Photographien, die gleichzeitig verkauft wurden, zu widerlegen, denn auf den Bildern sah man den Hungerkünstler an einem vierzigsten Hungertag, im Bett, fast verlöscht vor Entkräftung. Diese dem Hungerkünstler zwar wohlbekannte, immer aber von neuem ihn entnervende Verdrehung der Wahrheit war ihm zuviel. Was die Folge der vorzeitigen Beendigung des Hungerns war, stellte man als die Ursache dar. Gegen diesen Unverstand, gegen diese Welt des Unverstands zu kämpfen war unmöglich. Noch hatte er immer wieder in gutem Glauben begierig am Gitter dem Impresario zugehört, beim Erscheinen der Photographien ließ er das Gitter jedesmal los, sank mit Seufzen ins Stroh zurück und das beruhigte Publikum konnte wieder herankommen und ihn besichtigen.
Wenn die Zeugen solcher Szenen paar Jahre später daran zurückdachten, wurden sie sich oft selbst unverständlich. Denn inzwischen war jener erwähnte Umschwung eingetreten, fast plötzlich war das geschehn, es mochte tiefere Gründe haben, aber wem lag daran sie aufzufinden, jedenfalls sah sich eines Tages der verwöhnte Hungerkünstler von der vergnügungssüchtigen Menge verlassen, die lieber zu andern Schaustellungen strömte; noch einmal jagte der Impresario mit ihm durch halb Europa um zu sehen ob sich nicht noch hie und da das alte Interesse wiederfände, alles vergeblich, wie in einem geheimen Einverständnis hatte sich überall geradezu eine Abneigung gegen das Schau-Hungern ausgebildet. Natürlich hatte das in Wirklichkeit nicht plötzlich so kommen können und man erinnerte sich jetzt nachträglich an manche zu ihrer Zeit im Rausch der Erfolge nicht genügend beachtete, nicht genügend unterdrückte Vorboten, aber jetzt etwas dagegen zu unternehmen war zu spät. Zwar war es sicher, daß einmal auch für das Hungern wieder die Zeit kommen werde, aber für die Lebenden war das kein Trost. Was sollte nun der Hungerkünstler tun? Der welchen Tausende umjubelt hatten, konnte sich nicht in Schaubuden auf kleinen Jahrmärkten zeigen und um einen andern Beruf zu ergreifen, war der Hungerkünstler nicht nur zu alt, sondern vor allem dem Hungern allzu fanatisch ergeben. So verabschiedete er denn den Impresario, den Genossen einer Laufbahn ohnegleichen, und ließ sich von einem großen Cirkus schnell engagieren, um seine Empfindlichkeit zu schonen sah er die Vertragsbedingungen gar nicht an.
Ein großer Cirkus mit seiner Unzahl von einander immer wieder ausgleichenden und ergänzenden Menschen und Tieren und Apparaten kann jeden und zu jeder Zeit gebrauchen, auch einen Hungerkünstler, bei entsprechend bescheidenen Ansprüchen natürlich, und außerdem war es ja in diesem besondern Fall nicht nur der Hungerkünstler selbst der engagiert wurde, sondern auch sein alter berühmter Name, ja man konnte bei der Eigenart dieser im zunehmenden Alter nicht abnehmenden Kunst nicht einmal sagen, daß ein ausgedienter, nicht mehr auf der Höhe seines Könnens stehender Künstler sich in einen ruhigen Cirkusposten flüchten wolle, im Gegenteil, der Hungerkünstler versicherte, daß er, was durchaus glaubwürdig war, ebenso gut hungere wie früher, ja er behauptete sogar, er werde, wenn man ihm seinen Willen lasse, und dies versprach man ihm ohne weiters, eigentlich erst jetzt die Welt in berechtigtes Erstaunen setzen, eine Behauptung allerdings, die mit Rücksicht auf die Zeitstimmung, welche der Hungerkünstler im Eifer leicht vergaß, bei den Fachleuten nur ein Lächeln hervorrief.
Im Grunde aber verlor auch der Hungerkünstler den Blick für die wirklichen Verhältnisse nicht und nahm es als selbstverständlich hin, daß man ihn mit seinem Käfig nicht etwa als Glanznummer mitten in die Manege stellte, sondern draußen, an einem im übrigen recht gut zugänglichen Ort, in der Nähe der Stallungen unterbrachte. Große bunt gemalte Aufschriften umrahmten den Käfig und verkündeten was dort zu sehen war. Wenn das Publikum in den Pausen der Vorstellung zu den Ställen drängte, um die Tiere zu besichtigen, war es fast unvermeidlich daß es beim Hungerkünstler vorüberkam und ein wenig dort halt machte, man wäre vielleicht länger bei ihm geblieben, wenn nicht in dem schmalen Gang die Nachdrängenden, welche diesen Aufenthalt auf dem Weg zu den ersehnten Ställen nicht verstanden, eine längere ruhige Betrachtung unmöglich gemacht hätten. Dieses war auch der Grund, warum der Hungerkünstler vor diesen Besuchzeiten, die er als seinen Lebenszweck natürlich herbeiwünschte, doch auch wieder zitterte. In der ersten Zeit hatte er die Vorstellungspausen kaum erwarten können, entzückt hatte er der sich heranwälzenden Masse entgegengesehn, bis er sich nur zu bald – auch die hartnäckigste, fast bewußte Selbsttäuschung hielt den Erfahrungen nicht stand – davon überzeugte, daß es zumindest der Absicht nach, immer wieder, ausnahmlos, lauter Stallbesucher waren. Und dieser Anblick von der Ferne blieb noch immer der schönste. Denn wenn sie bis zu ihm herangekommen waren, umtobte ihn sofort Geschrei und Schimpfen der neu sich bildenden zwei Parteien, jener welche – sie wurde dem Hungerkünstler bald die peinlichere – ihn bequem ansehn wollte, nicht etwa aus Verständnis, sondern aus Laune und Trotz, und jener zweiten, die zunächst nur nach den Ställen verlangte. War der große Haufe vorüber dann kamen die Nachzügler und diese allerdings, denen es nicht mehr verwehrt war, stehen zu bleiben, solange sie Lust hatten, eilten fast ohne Seitenblick mit langen Schritten vorüber, um rechtzeitig zu den Tieren zu kommen. Und es war kein allzu häufiger Glücksfall, daß ein Familienvater mit seinen Kindern kam, mit dem Finger auf den Hungerkünstler zeigte, ausführlich erklärte, um was es sich hier handele, von frühernJahren erzählte, wo er bei ähnlichen aber unvergleichlich großartigeren Vorführungen gewesen war, und dann die Kinder wegen ihrer ungenügenden Vorbereitung von Schule und Leben her zwar immer noch verständnislos blieben – was war ihnen Hungern? – aber doch in dem Glanz ihrer forschenden Augen etwas von neuen, kommenden, gnädigeren Zeiten verrieten. Vielleicht – so sagte sich der Hungerkünstler dann manchmal – würde alles doch ein wenig besser werden, wenn sein Standort nicht gar so nahe bei den Ställen wäre. Den Leuten wurde dadurch die Wahl zu leicht gemacht, nicht zu reden davon daß ihn die Ausdünstungen der Ställe, die Unruhe der Tiere in der Nacht, das Vorübertragen der rohen Fleischstücke für die Raubtiere, die Schreie bei der Fütterung sehr verletzten und dauernd bedrückten. Aber bei der Direktion vorstellig zu werden wagte er nicht, mußte er nicht froh sein, daß man ihn wenigstens hier hungern ließ, immerhin verdankte er ja den Tieren die Menge der Besucher, unter denen sich hie und da auch ein für ihn Bestimmter finden konnte, und wer wußte, wohin man ihn verstecken würde, wenn er an seine Existenz erinnern wollte und damit auch daran, daß er genau genommen, nur ein Hindernis auf dem Weg zu den Ställen war.
Ein kleines Hindernis allerdings, ein immer kleiner werdendes Hindernis. Man gewöhnte sich an die Sonderbarkeit, in den heutigen Zeiten Aufmerksamkeit für einen Hungerkünstler beanspruchen zu wollen und mit dieser Gewöhnung war das Urteil über ihn gesprochen. Er mochte so gut hungern, als er nur konnte, und er tat es, aber nichts konnte ihn mehr retten, man ging an ihm vorüber. Versuche jemandem die Hungerkunst zu erklären! Wer es nicht fühlt, dem kann man es nicht begreiflich machen. Die schönen Aufschriften wurden schmutzig und unleserlich, man riß sie herunter, niemandem fiel es ein sie zu ersetzen, das Täfelchen mit der Ziffer der abgeleisteten Hungertage, das in der ersten Zeit sorgfältig täglich erneut worden war, blieb schon längst immer das gleiche, denn nach den ersten Wochen war das Personal selbst dieser kleinen Arbeit überdrüssig geworden und so hungerte zwar der Hungerkünstler weiter, wie er es früher einmal erträumt hatte und es gelang ihm ohne Mühe ganz so wie er es damals vorausgesagt hatte, aber niemand zählte die Tage, niemand, nicht einmal der Hungerkünstler selbst wußte wie groß die Leistung schon war und sein Herz wurde schwer. Und wenn einmal in der Zeit ein Müßiggänger stehn blieb, sich über die alte Ziffer lustig machte und von Schwindel sprach, so war das in diesem Sinn die dümmste Lüge, welche Gleichgültigkeit, Gedankenlosigkeit und eingeborene Bösartigkeit erfinden konnte, denn nicht der Hungerkünstler betrog, er arbeitete ehrlich, aber die Welt betrog ihn um seinen Lohn.
Doch vergingen wieder viele Tage und auch das nahm ein Ende. Einmal fiel einem Aufseher der Käfig auf und er fragte die Diener, warum man hier diesen gut brauchbaren Käfig mit dem verfaulten Stroh drinnen unbenützt stehen lasse, niemand wußte es, bis sich einer mit Hilfe der Ziffertafel an den Hungerkünstler erinnerte. Man rührte mit Stangen das Stroh auf und fand den Hungerkünstler darin. "Du hungerst noch immer?" fragte der Aufseher, "wann wirst Du denn endlich aufhören?" "Verzeiht mir alle", flüsterte der Hungerkünstler, nur der Aufseher, der das Ohr ans Gitter hielt, verstand ihn. "Gewiß", sagte der Aufseher und legte den Finger an die Stirn, um damit den Zustand des Hungerkünstlers dem Personal anzudeuten, "wir verzeihen Dir." "Immerfort wollte ich, daß Ihr mein Hungern bewundert", sagte der Hungerkünstler. "Wir bewundern es auch", sagte der Aufseher entgegenkommend. "Ihr sollt es aber nicht bewundern", sagte der Hungerkünstler. "Nun, dann bewundern wir es also nicht", sagte der Aufseher. "Warum sollen wir es denn nicht bewundern?" "Weil ich hungern muß, ich kann nicht anders", sagte der Hungerkünstler. "Da sieh mal einer", sagte der Aufseher, "warum kannst Du denn nicht anders?" "Weil ich", sagte der Hungerkünstler, hob das Köpfchen ein wenig und sprach mit wie zum Kuß gespitzten Lippen gerade in das Ohr des Aufsehers hinein, damit nichts verloren ginge, "weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie Du und alle. " Das waren die letzten Worte, aber noch in seinen gebrochenen Augen war die feste, wenn auch nicht mehr stolze Überzeugung daß er weiterhungre.
"Nun macht aber Ordnung", sagte der Aufseher und man begrub den Hungerkünstler samt dem Stroh. In den Käfig aber gab man einen jungen Panther. Es war eine selbst dem stumpfsten Sinn fühlbare Erholung in dem solange öden Käfig dieses wilde Tier sich herumwerfen zu sehn. Ihm fehlte nichts. Die Nahrung, die ihm schmeckte, brachten ihm ohne langes Nachdenken die Wächter, nicht einmal die Freiheit schien er zu vermissen, dieser edle, mit allem nötigen bis knapp zum Zerreißen ausgestattete Körper schien auch die Freiheit mit sich herumzutragen, irgendwo im Gebiß schien sie zu stecken, und die Freude am Leben kam mit derart starker Glut aus seinem Rachen, daß es für die Zuschauer nicht leicht war ihr standzuhalten. Aber sie überwanden sich, umdrängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren.
Ein Freund den ich schon viele Jahre, mehr als zwanzig, nicht gesehen hatte und von dem ich auch nur sehr unregelmäßige, oft jahrelang ausbleibende Nachrichten bekommen hatte, sollte nun wieder einmal in unsere Stadt, in seine Vaterstadt zurückkommen. Ich hatte ihm, da er keine Verwandten mehr hier besaß und unter seinen Freunden ich der bei weitem ihm nächste war, ein Zimmer bei mir angeboten und hatte die Freude die Einladung angenommen zu sehn. Die Einrichtung des Zimmers im Sinne meines Freundes zu vervollständigen ließ ich mir sehr angelegen sein, ich suchte mich an seine Eigenheiten zu erinnern, an besondere Wünsche, die er manchmal, besonders bei unsern gemeinsamen Ferienreisen ausgesprochen hatte, suchte mich daran zu erinnern, was er in seiner nächsten Umgebung geliebt und was er verabscheut hatte, suchte mir in Einzelnheiten vorzustellen, wie sein Jungenzimmer ausgesehen hatte, fand aber aus alledem nichts, was ich in meiner Wohnung um sie ihm etwa heimischer zu machen, hätte einrichten können. Er stammte aus einer ärmlichen vielköpfigen Familie, Not und Lärm und Zank waren die Kennzeichen der Wohnung gewesen. Ich sah in der Erinnerung noch genau das Zimmer neben der Küche, in dem wir manchmal, selten genug, allein uns zusammenducken konnten, während nebenan in der Küche die übrige Familie ihre Streitigkeiten austrug, an denen es hier niemals fehlte; Ein kleines dunkles Zimmer mit unausrottbarem Kaffeegeruch, denn die Tür zu der noch dunkleren Küche war Tag und Nacht offen. Dort saßen wir beim Fenster, das auf eine überdeckte, den Hof umlaufende Pawlatsche hinausgieng und spielten Schach. Zwei Figuren fehlten in unserem Spiel ’und wir mußten sie durch Hosenknöpfe ersetzen, dadurch entstanden zwar wenn wir die Bedeutung der Knöpfe verwechselten oft Schwierigkeiten, aber wir waren an diesen Ersatz gewöhnt und blieben dabei. Nebenan auf dem Gang wohnte ein Paramentenhändler, ein lustiger aber unruhiger Mann mit einem lang ausgezogenen Schnurrbart, an dem er wie auf einer Flöte herumgriff. Wenn dieser Mann abend nachhause gieng, mußte er an unserem Fenster vorüberkommen, dann blieb er gewöhnlich stehn, lehnte sich zu uns ins Zimmer herein und sah uns zu. Fast immer war er mit unserem Spiel unzufrieden, mit meinem wie mit dem des Freundes, gab ihm und mir Ratschläge, ergriff dann selbst die Figuren und machte Züge, die wir gelten lassen mußten, denn wenn wir sie ändern wollten, schlug er unsere Hände nieder; lange duldeten wir es, denn er war ein besserer Spieler als wir, nicht viel besser, aber doch so, daß wir von ihm lernen konnten, aber als er einmal, als es schon dunkel war, sich zu uns vorbeugte, das ganze Brett uns fortnahm und es vor sich auf das Fensterbrett legte, um sich den Spielstand genau ansehn zu können, stand ich, der ich gerade beim Spiel in wesentlichem Vorteil war und dies durch sein grobes Eingreifen gefährdet glaubte, in dem nichts überlegenden Zorn des Knaben, dem ein offenbares Unrecht geschieht, auf und sagte, daß er uns im Spiel störe. Er sah uns kurz an, nahm wieder das Brett, legte es mit ironisch übertriebener Bereitwilligkeit wieder auf den alten Platz, ging fort und kannte uns von da an nicht mehr. Nur immer, wenn er am Fenster vorüberkam, machte er ohne zu uns hereinzusehn, eine wegwerfende Bewegung mit der Hand. Zuerst feierten wir das Ganze als einen großen Sieg, aber dann fehlte er uns doch mit seinen Belehrungen, seiner Lustigkeit, seiner ganzen Teilnahme, wir vernachlässigten ohne damals genau den Grund zu wissen, das Spiel und wandten uns bald gänzlich andern Dingen zu. Wir fingen an Marken zu sammeln und es war, wie ich erst nachträglich verstand das Zeichen einer fast unbegreiflich engen Freundschaft, daß wir ein gemeinsames Markenalbum hatten. Eine Nacht wurde es immer bei mir aufbewahrt, die nächste bei ihm. Die durch diesen gemeinsamen Besitz schon an und für sich entstehenden Schwierigkeiten wurden noch dadurch erhöht, daß mein Freund überhaupt zu mir in die Wohnung nicht kommen durfte, meine Eltern erlaubten es nicht. Dieses Verbot war nicht eigentlich gegen ihn gerichtet, den die Eltern kaum kannten, sondern gegen seine Eltern, gegen seine Familie. In diesem Sinn war es auch wahrscheinlich nicht unbegründet, aber in seiner Form war es doch nicht sehr verständig, denn es wurde ja dadurch nichts anderes erreicht, als daß ich täglich zu meinem Freunde ging und dadurch in den Dunstkreis jener Familie noch viel tiefer geriet, als wenn der Freund zu uns hätte kommen dürfen. Bei meinen Eltern regierte eben statt des Verstandes oft nur Tyrannei, nicht nur mir gegenüber, sondern auch der Welt gegenüber. In diesem Fall genügte es ihnen – und hier war die Mutter mehr beteiligt als der Vater – daß die Familie meines Freundes durch dieses Verbot bestraft und herabgewürdigt war, daß ich dadurch in Mitleidenschaft gezogen war, ja daß mich die Eltern des Freundes in natürlicher Gegenwehr spöttisch und verächtlich behandelten, wußten meine Eltern allerdings nicht, bekümmerten sich aber um mich in dieser Richtung gar nicht und es hätte sie auch, wenn sie es erfahren hätten, nicht sehr berührt. So beurteile ich das Ganze natürlich nur im Rückblick, damals waren wir zwei Freunde mit dem Stand der Dinge genug zufrieden und das Leid wegen der Unvollkommenheit der Erdendinge drang noch nicht zu uns, es war umständlich das Album täglich hin- und herzutragen, aber
Es kam Gesang aus einer Kneipe, ein Fenster war geöffnet, es war nicht eingehakt und schwankte hin und her. Es war eine kleine Hütte, ebenerdig und ringsum war Leere, es war schon weit vor der Stadt. Es kam ein später Gast, schleichend, auf den Fußspitzen, in enganliegendem Kleid, tastete sich vor, wie im Finstern und es war doch Mondlicht. Horchte am Fenster, schüttelte den Kopf, verstand nicht, wie dieser schöne Gesang aus einer solchen Kneipe kam, schwang sich rücklings auf das Fensterbrett, unvorsichtig wohl; denn er konnte sich nicht oben erhalten und fiel gleich ins Innere, aber nicht tief, denn beim Fenster stand ein Tisch. Die Weingläser flogen zu Boden, zwei Männer, die bei dem Tisch gesessen waren, erhoben sich und warfen kurz entschlossen den neuen Gast, die Füße hatte er ja noch außen, wieder durch das Fenster zurück, er fiel in weiches Gras, stand gleich auf und horchte, aber der Gesang hatte aufgehört.
Der Ort hieß Thamüll. Es war dort sehr feucht
In der Thamühler Synagoge lebt ein Tier von der Größe und Gestalt etwa eines Marders,
Die Synagoge von Thamühl ist ein einfacher kahler niedriger Bau aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts. So klein die Synagoge ist, so reicht sie doch völlig aus, denn auch die Gemeinde ist klein und verkleinert sich von Jahr zu Jahr. Schon jetzt macht es der Gemeinde Mühe die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen und es gibt Einzelne, welche offen sagen, daß ein kleines Betzimmer durchaus dem Gottesdienst genügen würde
In unserer Synagoge lebt ein Tier in der Größe etwa eines Marders. Es ist oft sehr gut zu sehn, bis auf eine Entfernung von etwa zwei Metern duldet es das Herankommen der Menschen. Seine Farbe ist ein helles Blaugrün. Sein Fell hat noch niemand berührt, es läßt sich also darüber nichts sagen, fast möchte man behaupten, daß auch die wirkliche Farbe des Felles unbekannt ist, vielleicht stammt die sichtbare Farbe nur vom Staub und Mörtel die sich im Fell verfangen haben, die Farbe ähnelt ja auch dem Verputz des Synagogeninnern, nur ist sie ein wenig heller. Es ist, von seiner Furchtsamkeit abgesehn, ein ungemein ruhiges seßhaftes Tier; würde es nicht so oft aufgescheucht werden, es würde wohl den Ort kaum wechseln, sein Lieblingsaufenthalt ist das Gitter der Frauenabteilung, mit sichtbarem Behagen krallt es sich in die Maschen des Gitters, streckt sich und blickt hinab in den Betraum, diese kühne Stellung scheint es zu freuen, aber der Tempeldiener hat den Auftrag, das Tier niemals am Gitter zu dulden, es würde sich an diesen Platz gewöhnen und das kann man wegen der Frauen, die das Tier fürchten, nicht zulassen. Warum sie es fürchten, ist unklar. Es sieht allerdings beim ersten Anblick erschreckend aus, besonders der lange Hals, das dreikantige Gesicht, die fast wagrecht vorstehenden Oberzähne, über der Oberlippe eine Reihe langer, die Zähne überragender, offenbar ganz harter heller Borstenhaare; das alles kann erschrecken, aber bald muß man erkennen, wie ungefährlich dieser ganze scheinbare Schrecken ist. Vor allem hält es sich ja von den Menschen fern, es ist scheuer als ein Waldtier, es scheint mit nichts als mit dem Gebäude verbunden und sein persönliches Unglück besteht wohl darin, daß dieses Gebäude eine Synagoge ist, also ein zeitweilig sehr belebter Ort. Könnte man sich mit dem Tier verständigen, könnte man es allerdings damit trösten, daß die Gemeinde unseres Bergstädtchens von Jahr zu Jahr kleiner wird und es ihr schon Mühe macht die Kosten für die Erhaltung der Synagoge aufzubringen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in einiger Zeit aus der Synagoge ein Getreidespeicher wird oder dergleichen und daß das Tier die Ruhe bekommt, die ihm jetzt schmerzlich fehlt.
Es sind allerdings nur die Frauen, die das Tier fürchten, den Männern ist es längst gleichgültig geworden, eine Generation hat es der andern gezeigt, immer wieder hat man es gesehn, schließlich hat man keinen Blick mehr daran gewendet und selbst die Kinder, die es zum erstenmal sehn, staunen nicht mehr. Es ist das Haustier der Synagoge geworden, warum sollte nicht die Synagoge ein besonderes, nirgends sonst vorkommendes Haustier haben? Wären nicht die Frauen man würde kaum mehr von der Existenz des Tieres wissen. Aber selbst die Frauen haben keine wirkliche Furcht vor dem Tier, es wäre auch zu sonderbar, ein solches Tier tagaus, tagein zu fürchten, jahre- und jahrzehntelang. Sie verteidigen sich zwar damit, daß ihnen das Tier meist viel näher ist als den Männern und das ist richtig. Hinunter zu den Männern wagt sich das Tier nicht, niemals hat man es noch auf dem Fußboden gesehn. Läßt man es nicht zum Gitter der Frauenabteilung, so hält es sich wenigstens in gleicher Höhe auf der gegenüberliegenden Wand auf. Dort ist ein ganz schmaler Mauervorsprung, kaum zwei Finger breit, er umläuft drei Seiten der Synagoge, auf diesem Vorsprung huscht das Tier manchmal hin und her, meistens aber hockt es ruhig auf einer bestimmten Stelle gegenüber den Frauen. Es ist fast unbegreiflich wie es diesen schmalen Weg so leicht benützen kann und die Art wie es dort oben, am Ende angekommen, wieder wendet, ist sehenswert, es ist doch schon ein sehr altes Tier, aber es zögert nicht den gewagtesten Luftsprung zu machen, der auch niemals mißlingt, in der Luft hat es sich umgedreht und schon läuft es wieder seinen Weg zurück. Allerdings wenn man das einigemal gesehen hat, ist man gesättigt und hat keinen Anlaß immerfort hinzustarren. Es ist ja auch weder Furcht noch Neugier, welche die Frauen in Bewegung hält, würden sie sich mehr mit dem Beten beschäftigen, könnten sie das Tier völlig vergessen, die frommen Frauen täten das auch, wenn es die andern, welche die große Mehrzahl sind zuließen, diese aber wollen immer gern auf sich aufmerksam machen und das Tier ist ihnen dafür ein willkommener Vorwand. Wenn sie es könnten und wenn sie es wagten, hätten sie gewiß das Tier noch näher zu sich gelockt, um noch mehr erschrecken zu dürfen. Aber in Wirklichkeit drängt sich ja das Tier gar nicht zu ihnen, es kümmert sich, wenn es nicht angegriffen wird, um sie ebensowenig wie um die Männer, am liebsten würde es wahrscheinlich in der Verborgenheit bleiben, in der es in den Zeiten außerhalb des Gottesdienstes lebt, offenbar in irgendeinem Mauerloch, das wir noch nicht entdeckt haben. Erst wenn man zu beten anfängt, erscheint es, erschreckt durch den Lärm, will es sehn was geschehen ist, will es wachsam bleiben, will es frei sein, fähig zur Flucht, vor Angst läuft es hervor, aus Angst macht es seine Kapriolen und wagt sich nicht zurückzuziehn, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Die Höhe bevorzugt es natürlich deshalb, weil es dort am sichersten ist und die besten Laufmöglichkeiten hat es auf dem Gitter und dem Mauervorsprung, aber es ist keineswegs immer dort, manchmal steigt es auch tiefer zu den Männern hinab, der Vorhang der Bundeslade wird von einer glänzenden Messingstange getragen, die scheint das Tier zu locken, oft genug schleicht es hin, dort aber sitzt es immer ruhig, nicht einmal wenn es dort knapp bei der Bundeslade ist, kann man sagen daß es stört, mit seinen blanken, immer offenen, vielleicht lidlosen Augen scheint es die Gemeinde anzusehn, sieht aber gewiß niemanden an, sondern blickt nur den Gefahren entgegen, von denen es sich bedroht fühlt.
In dieser Hinsicht schien es, wenigstens bis vor kurzem, nicht viel verständiger als unsere Frauen. Was für Gefahren hat es denn zu fürchten? Wer beabsichtigt ihm etwas zu tun? Lebt es denn nicht seit vielen Jahren völlig sich selbst überlassen? Die Männer kümmern sich nicht um seine Anwesenheit und die Mehrzahl der Frauen wäre wahrscheinlich unglücklich wenn es verschwände. Und da es das einzige Tier im Haus ist, hat es also überhaupt keinen Feind. Das hätte es nachgerade im Laufe der Jahre schon durchschauen können. Und der Gottesdienst mit seinem Lärm mag ja für das Tier sehr erschreckend sein, aber er wiederholt sich doch in bescheidenem Ausmaß jeden Tag und gesteigert an den Feststagen, immer regelmäßig und ohne Unterbrechung, auch das ängstlichste Tier hätte sich schon daran gewöhnen können, besonders wenn es sieht, daß es nicht etwa der Lärm von Verfolgern ist, sondern ein Lärm der es gar nicht betrifft. Und doch diese Angst. Ist es die Erinnerung an längst vergangene oder die Vorahnung künftiger Zeiten Weiß dieses alte Tier vielleicht mehr, als die drei Generationen, die jeweils in der Synagoge versammelt sind?
Vor vielen Jahren, so erzählt man, soll man wirklich versucht haben das Tier zu vertreiben. Es ist ja möglich daß es wahr ist, wahrscheinlicher aber ist es daß es sich nur um erfundene Geschichten handelt. Nachweisbar allerdings ist, daß man damals vom religionsgesetzlichen Standpunkt aus die Frage untersucht hat, ob man ein solches Tier im Gotteshause dulden darf. Man holte die Gutachten verschiedener berühmter Rabbiner ein, die Ansichten waren geteilt, die Mehrheit war für die Vertreibung und Neueinweihung des Gotteshauses, aber es war leicht von der Ferne zu dekretieren, in Wirklichkeit war es ja unmöglich, das Tier zu vertreiben.
Ich war in ein undurchdringliches Dornengebüsch geraten und rief laut den Parkwächter. Er kam gleich, konnte aber nicht zu mir vordringen. "Wie sind Sie denn dort mitten in das Dornengebüsch gekommen", rief er, "können Sie nicht auf dem gleichen Weg wieder zurück?" "Unmöglich", rief ich, "ich finde den Weg nicht wieder, Ich bin in Gedanken ruhig spazieren gegangen und plötzlich fand ich mich hier, es ist wie wenn das Gebüsch erst gewachsen wäre nachdem ich hier war. Ich komme nicht mehr hinaus, ich bin verloren. " "Sie sind wie ein Kind", sagte der Wächter, "zuerst drängen Sie sich auf einem verbotenen Weg durch das wildeste Gebüsch und dann jammern Sie. Sie sind doch nicht in einem Urwald sondern im öffentlichen Park und man wird Sie herausholen." "So ein Gebüsch gehört aber nicht in einen Park", sagte ich, "und wie will man mich retten, es kann doch niemand herein. Will man es aber versuchen, dann muß man es gleich tun, es ist ja gleich Abend, die Nacht halte ich hier nicht aus, ich bin auch schon ganz zerkratzt von den Dornen und mein Zwicker ist mir hinuntergefallen und ich kann ihn nicht finden, ich bin ja halbblind ohne Zwicker." "Das ist alles gut und schön", sagte der Wächter, "aber ein Weilchen werden Sie sich noch gedulden müssen, ich muß doch zuerst Arbeiter holen, die den Weg aushacken, und vorher noch die Bewilligung des Herrn Parkdirektors einholen. Also ein wenig Geduld und Männlichkeit, wenn ich bitten darf. "
Es kam ein Herr zu uns, den ich schon öfters gesehn hatte, ohne ihm aber eine Bedeutung beizumessen. Er ging mit den Eltern ins Schlafzimmer, sie waren ganz gefangen von dem was er sprach und schlossen geistesabwesend die Tür hinter sich; als ich ihnen nachgehen wollte, hielt mich Frieda, die Köchin zurück, natürlich schlug ich um mich und weinte, aber Frieda war die stärkste Köchin an die ich mich erinnern kann, sie verstand es, meine Hände mit unwiderstehlichem Griff zu pressen und dabei mich so weit vom Leib zu halten, daß ich sie mit den Füßen nicht erreichen konnte. Dann war ich wehrlos und konnte nur schimpfen. "Du bist wie ein Dragoner", schrie ich, "schäm Dich, bist ein Mädchen und bist doch wie ein Dragoner. " Aber mit nichts konnte ich sie in Erregung bringen, sie war ein ruhiges, fast melancholisches Mädchen. Sie ließ erst von mir ab, als die Mutter aus dem Schlafzimmer herauskam, um etwas aus der Küche zu holen. Ich hing mich an den Rock der Mutter. "Was will der Herr?" fragte ich. "Ach", sagte sie und küßte mich, "es ist nichts, er will nur, daß wir verreisen." Da freute ich mich sehr, denn im Dorf, wo wir immer während der Ferien waren, war es viel schöner als in der Stadt. Aber die Mutter erklärte mir, daß ich nicht mitfahren könne, ich müsse doch in die Schule gehn, es seien ja keine Ferien und jetzt komme der Winter, auch würden sie nicht ins Dorf fahren, sondern in eine Stadt, viel weiter, doch verbesserte sie sich, als sie sah wie ich erschrak und sagte, nein, die Stadt sei nicht weiter, sondern viel näher als das Dorf. Und als ich es nicht recht glauben konnte, führte sie mich zum Fenster und sagte, die Stadt sei so nahe, daß man sie fast vom Fenster aus sehen könne, aber das stimmte nicht, wenigstens nicht an diesem trüben Tag, denn man sah nichts weiter als was man immer sah: die enge Gasse unten und die Kirche gegenüber. Dann ließ sie mich stehn, lief in die Küche, kam mit einem Glas Wasser, winkte Frieda ab, die wieder gegen mich losgehn wollte und schob mich vor sich her ins Schlafzimmer hinein. Dort saß der Vater müde im Lehnstuhl und langte schon nach dem Wasser. Als er mich sah, lächelte er und fragte, was ich dazu sage, daß sie verreisen würden. Ich sagte, daß ich sehr gern mitfahren würde. Er sagte aber, daß ich noch zu klein sei und es sei eine sehr anstrengende Reise. Ich fragte warum sie denn fahren müssen. Der Vater zeigte auf den Herrn. Der Herr hatte goldene Rockknöpfe und putzte eben einen mit dem Taschentuch. Ich bat ihn er möge die Eltern zuhause lassen, denn wenn sie wegfahren würden, müßte ich mit Frieda allein bleiben und das sei unmöglich
Es rollen die Räder des goldenen Wagens, knirschend im Kies machen sie Halt, ein Mädchen will aussteigen, schon berührt ihre Fußspitze den Wagentritt, da sieht sie mich und schlüpft in den Wagen zurück.
Das Synagogentier – Seligmann und Graubart – Ist das schon Ernst? – Der Bauarbeiter
Es war einmal ein Geduldspiel, ein billiges einfäches Spiel, nicht viel größer als eine Taschenuhr und ohne irgendwelche überraschende Einrichtungen. In der rotbraun angestrichenen Holzfläche waren einige blaue Irrwege eingeschnitten die in eine kleine Grube mündeten. Die gleichfalls blaue Kugel war durch Neigen und Schütteln zunächst in einen der Wege zu bringen und dann in die Grube. War die Kugel in der Grube, dann war das Spiel zuende, wollte man es von neuem beginnen, mußte man die Kugel wieder aus der Grube schütteln. Bedeckt war das Ganze von einem starken gewölbten Glas, man konnte das Geduldspiel in die Tasche stecken und mitnehmen und wo immer man war, konnte man es hervornehmen und spielen.
War die Kugel unbeschäftigt, so ging sie meistens, die Hände auf dem Rücken, auf der Hochebene hin und her, die Wege vermied sie. Sie war der Ansicht, daß sie während des Spieles genug mit den Wegen gequält werde und daß sie reichlichen Anspruch darauf habe, wenn nicht gespielt würde, sich auf der freien Ebene zu erholen. Sie hatte einen breitspurigen Gang und behauptete, daß sie nicht für die schmalen Wege gemacht sei. Das war zum Teil richtig, denn die Wege konnten sie wirklich kaum fassen, es war aber auch unrichtig, denn tatsächlich war sie sehr sorgfältig der Breite der Wege angepaßt, bequem aber durften ihr die Wege nicht sein, denn sonst wäre es kein Geduldspiel gewesen.
Es wurde mir erlaubt in einen fremden Garten einzutreten. Beim Eingang waren einige Schwierigkeiten zu überwinden, aber schließlich stand hinter einem Tischchen ein Mann halb auf und steckte mir eine dunkelgrüne Marke, die von einer Stecknadel durchstochen war ins Knopfloch. Durch einen Blick verständigten wir uns darüber, daß ich jetzt eintreten könne. Aber nach paar Schritten erinnerte ich mich, daß ich noch nicht gezahlt hatte. Ich wollte umkehren, aber da sah ich eine große Dame in einem Reisemantel aus gelblich-grauem grobem Stoff eben bei dem Tischchen stehn und eine Anzahl winziger Münzen auf den Tisch zählen. "Das ist für Sie", rief der Mann, der meine Unruhe wahrscheinlich bemerkt hatte, über den Kopf der tief hinabgebeugten Dame mir zu. >>Für mich?" fragte ich ungläubig und sah hinter mich, ob nicht jemand anderer gemeint war. "Immer diese Kleinlichkeit", sagte ein Herr, der vom Rasen herkam, langsam den Weg vor mir querte und wieder im Rasen weiterging. "Für Sie. Für wen denn sonst? Hier zahlt einer für den andern." Ich dankte für die allerdings unwillig gegebene Auskunft, machte aber den Herrn darauf aufmerksam, daß ich für niemanden gezahlt hatte. "Für wen sollten Sie denn zahlen?" sagte der Herr im Weggehn. Jedenfalls wollte ich auf die Dame warten und mich mit ihr zu verständigen suchen, aber sie nahm einen andern Weg, mit ihrem Mantel rauschte sie dahin, zart flatterte hinter der mächtigen Gestalt ein bläulicher Hutschleier. "Sie bewundern Isabella", sagte ein Spaziergänger neben mir und sah gleichfalls der Dame nach. Nach einer Weile sagte er: "Das ist Isabella. "
Die Heirat Lisbeth Seligmanns mit Franz Graubart war sehr sorgfältig vorbereitet.
Der Gefängniswärter wollte das Tor aufsperren, aber das Schloß war rostig, die Kräfte des alten Mannes genügten nicht, der Gehilfe mußte heran, er machte aber ein zweifelndes Gesicht, nicht wegen des rostigen Schlosses,
Die Helden wurden aus dem Gefängnis entlassen, sie ordneten sich ungeschickt in einer Reihe, durch die Haft hatten sie an Beweglichkeit sehr verloren. Mein Freund der Gefangenenaufseher, nahm aus seiner Aktenmappe das Heldenverzeichnis, es war das einzige Schriftstück in seiner Mappe, wie ich ohne jede Bosheit – es war doch keine Schreiberanstellung – bemerkte, und machte sich daran, die Helden einzeln aufzurufen und die Namen im Verzeichnis dann abzustreichen. Ich saß seitlich an seinem Schreibtisch und überblickte mit ihm die Reihe der Helden.
Entschuldigen Sie, daß ich plötzlich so zerstreut wurde. Sie machen mir die Mitteilung von Ihrer Verlobung, die erfreulichste Nachricht, die es geben kann, und ich werde plötzlich teilnahmslos und scheine mich mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen. Es ist aber gewiß nur scheinbare Teilnahmslosigkeit, mir ist nämlich eine Geschichte eingefallen, eine alte Geschichte, die ich einmal in der Nähe, aber immerhin in aller Sicherheit miterlebt habe, in aller Sicherheit und doch beteiligter, als bei Dingen die mich geradezu betrafen. Es liegt das an der Sache, man konnte damals nicht unbeteiligt bleiben, selbst wenn man nur den letzten Zipfel der Geschichte zu sehen bekommen hätte.
Don Quichote mußte auswandern, ganz Spanien lachte über ihn, er war dort unmöglich geworden. Er reiste durch Südfrankreich, wo er hier und da liebe Leute traf, mit denen er sich anfreundete, überstieg mitten im Winter unter den größten Mühen und Entbehrungen die Alpen, zog dann durch die oberitalienische Tiefebene, wo er sich aber nicht wohlfühlte und kam endlich nach Mailand.
Auf den Gütern der M’schen Herrschaft hat sich die Einführung eines sogenannten Aufpeitschers sehr bewährt. Mit Erfolg wird diese Neueinrichtung anderswo allerdings nur dann nachgeahmt werden können, wenn man sich einer Person versichern kann, die für dieses Amt so vorzüglich geeignet ist, wie der Aufpeitscher in M. Der Fürst selbst hat ihn entdeckt, kurz vor der eigentlichen Erntearbeit geht der Fürst auf den Krückstock gestützt durch die Hauptstraße des Dorfes, er ist noch nicht alt, muß aber schon seit einigen Jahren den Krückstock benützen wegen irgendeines Beinleidens, das jetzt noch nicht arg ist, aber, wie die Ärzte befürchten sich gefährlich entwickeln kann. Wie nun der Fürst langsam dahin geht, hie und da auf den Stock gestützt auch stehn bleibt, die vorteilhafteste Einteilung der Erntearbeit überlegt – er ist ein sehr tätiger, mit sachlicher Freude tätiger Landwirt – und bei diesen Überlegungen immer wieder daran stößt, daß es trotz unsinnig steigender Löhne an Arbeitskräften fehlt oder vielmehr daß Arbeitskräfte eigentlich im Überfluß vorhanden wären, wenn nur diese Kräfte auch wirklich arbeiten wollten, wie es sein soll und wie es auf den Feldern der Bauern auch geschieht, aber auf den herrschaftlichen Feldern leider ganz und gar nicht, wie er alles dieses schon vielfach Durchdachte mit Zorn – auch macht sich der kranke Fuß bemerkbarer als sonst – wieder einmal durchdenkt, bemerkt er auf der Schwelle einer halb verfallenen Hütte einen Burschen, der ihm dadurch auffällt, daß er wohl schon zwanzig Jahre alt ist, aber bloßfüßig, in Schmutz und Fetzen wie ein kleiner unnützer Schuljunge aussieht.
Es ist Isabella, der Apfelschimmel, das alte Pferd, ich hätte sie in der Menge nicht erkannt, sie ist eine Dame geworden, wir trafen einander letzthin in einem Garten bei einem Wohltätigkeitsfest. Es ist dort eine kleine, abseits liegende Baumgruppe, die einen kühlen beschatteten Wiesenplatz einschließt, mehrere schmale Wege durchziehen ihn, es ist zu Zeiten sehr angenehm dort zu sein. Ich kenne den Garten von früher her und als ich des Festes müde war, bog ich in jene Baumgruppe ein. Kaum trete ich unter die Bäume, sehe ich von der andern Seite eine große Dame mir entgegenkommen; ihre Größe machte mich fast bestürzt, es war niemand sonst in der Nähe, mit dem ich sie hätte vergleichen können, aber ich war überzeugt, daß ich keine Frau kannte, welche dieser nicht um mehrere Kopflängen – im ersten Staunen dachte ich gar um unzählige – nachstehen mußte. Aber als ich näherkam, war ich bald beruhigt. Isabella, die alte Freundin! "Wie bist Du denn aus deinem Stall entwichen?" "Ach, es war nicht schwer, ich werde ja eigentlich nur gnadenweise noch gehalten, meine Zeiten sind vorüber, erkläre ich meinem Herrn, daß ich, statt unnütz im Stall zu stehn, nun auch noch ein wenig die Welt kennen lernen will, solange die Kräfte reichen, erkläre ich das meinem Herrn, versteht er mich, sucht einige Kleider der Seligen aus, hilft mir noch beim Anziehn und entläßt mich mit guten Wünschen. " "Wie schön Du bist! " sage ich, nicht ganz ehrlich, nicht ganz lügnerisch
Auch Frieda wartet, aber nicht auf K; sie beobachtet den Herrenhof und beobachtet K; sie darf ruhig sein, ihre Lage ist günstiger, als sie selbst erwartet hat, sie kann neidlos zusehn, wie Pepi sich abmüht, wie Pepi’s Ansehen wächst, sie wird ja zu rechter Zeit ein Ende machen, sie kann auch ruhig zusehn, wie K. sich fern von ihr herumtreibt, dazu, daß er sie völlig verläßt, wird sie es nicht kommen lassen.
Der allerunterste Raum des Oceandampfers, der das ganze Schiff durchgeht, ist völlig leer, allerdings ist er kaum ein Meter hoch. Die Konstruktion des Schiffes verlangt diesen leeren Raum. Ganz leer ist er freilich nicht, er gehört den Ratten
Ich kann die Untersuchung überall anfangen, wo es mir
Ich habe seit jeher einen gewissen Verdacht gegen mich gehabt. Aber es geschah nur hie und da, zeitweilig, lange Pausen waren dazwischen, hinreichend um zu vergessen. Es waren außerdem Geringfügigkeiten, die gewiß auch bei andern vorkommen und dort nichts Ernstliches bedeuten, etwa das Staunen über das eigene Gesicht im Spiegel, oder über das Spiegelbild des Hinterkopfes oder auch der ganzen Gestalt, wenn man plötzlich auf der Gasse an einem Spiegel vorüberkommt.
Ich habe seitjeher einen gewissen Verdacht gegen mich gehabt, einen Verdacht ähnlich etwa demjenigen, den ein angenommenes Kind gegen seine Pflegeeltern hat, auch wenn es sorgfältig in dem Glauben erhalten wird, daß die Pflegeeltern seine leiblichen Eltern sind. Es ist irgendein Verdacht da, mögen auch die Pflegeeltern das Kind wie ihr eigenes lieben und nichts an Zärtlichkeit und Geduld verabsäumen, es ist ein Verdacht, der sich vielleicht nur zeitweilig, nur nach langen Zwischenpausen, nur bei kleinen zufälligen Gelegenheiten äußert, der aber doch lebendig ist, wenn er einmal ruht, nicht verschwunden ist sondern Kräfte sammelt, in günstiger Stunde mit einem Sprung aus winzigem Unbehagen ein großer wilder böser keine Fessel mehr ertragender Verdacht werden kann und der bedenkenlos alles, den Verdächtigenden mit dem Verdächtigen gemeinsam zerstört. Ich fühle seine Regung wie die Schwangere die Bewegung des Kindes fühlt und ich weiß außerdem, daß ich seine wirkliche Geburt nicht überleben werde. Lebe schöner Verdacht, großer mächtiger Gott, und laß mich sterben, der ich Dich geboren habe, der Du Dich von mir gebären ließest.
Ich heiße Kalmus, es ist kein ungewöhnlicher Name und doch reichlich sinnlos. Er hat mir immer zu denken gegeben. >Wie?< sagte ich mir, >Du heißt Kalmus? Stimmt denn das?< Es gibt viele Leute, selbst wenn man sich nur auf Deine große Verwandtschaft beschränkt, die Kalmus heißen und durch ihr Dasein diesem an sich sinnlosen Namen einen recht guten Sinn geben. Sie sind als Kalmus geboren und werden als solche in Frieden sterben, zumindest was den Frieden mit dem Namen betrifft.
Wie sich mein Leben verändert hat und wie es sich doch nicht verändert hat im Grunde! Wenn ich jetzt zurückdenke und die Zeiten mir zurückrufe, da ich noch inmitten der Hundeschaft lebte, teilnahm an allem was sie bekümmert, ein Hund unter Hunden, finde ich bei näherem Zusehn doch, daß hier seit jeher etwas nicht stimmte, eine kleine Bruchstelle vorhanden war, ein leichtes Unbehagen inmitten der ehrwürdigsten volklichen Veranstaltungen mich befiel, ja manchmal selbst im vertrauten Kreise, nein, nicht manchmal, sondern sehr oft, der bloße Anblick eines mir lieben Mithundes, der bloße Anblick, irgendwie neu gesehn, mich verlegen, erschrocken, hilflos, ja mich verzweifelt machte. Ich suchte mich gewissermaßen zu begütigen, Freunde, denen ich es eingestand halfen mir, es kamen wieder ruhigere Zeiten, Zeiten in denen zwar jene Überraschungen nicht fehlten, aber gleichmütiger aufgenommen, gleichmütiger ins Leben eingefügt wurden, vielleicht traurig und müde machten, aber im übrigen mich bestehen ließen als einen zwar ein wenig kalten, zurückhaltenden, ängstlichen, rechnerischen, aber alles in allem genommen doch regelrechten Hund. Wie hätte ich auch ohne diese Erholungspausen das Alter erreichen können, dessen ich mich jetzt erfreue, wie hätte ich mich durchringen können zu der Ruhe, mit der ich die Schrecken meiner Jugend betrachte und die Schrecken des Alters ertrage, wie hätte ich dazu kommen können, die Folgerungen aus meiner, wie ich zugebe, unglücklichen oder um es vorsichtiger auszudrücken nicht sehr glücklichen Anlage zu ziehn und fast völlig ihnen entsprechend zu leben. Zurückgezogen, einsam, nur mit meinen kleinen, hoffnungslosen, aber mir unentbehrlichen Untersuchungen beschäftigt, so lebe ich, habe aber dabei von der Ferne den Überblick über mein Volk nicht verloren, oft dringen Nachrichten zu mir und auch ich lasse hie und da von mir hören. Man behandelt mich mit Achtung, versteht meine Lebensweise nicht, aber nimmt sie mir nicht übel und selbst junge Hunde, die ich hie und da in der Ferne vorüberlaufen sehe, eine neue Generation, an deren Kindheit ich mich kaum dunkel erinnere, versagen mir nicht den ehrerbietigen Gruß. Man darf eben nicht außerachtlassen, daß ich trotz meiner Sonderbarkeiten, die offen zu Tage liegen, doch nicht völlig aus der Art schlage. Es ist ja, wenn ichs bedenke und dies zu tun habe ich Zeit und Lust und Fähigkeit, mit der Hundeschaft überhaupt sonderbar bestellt. Es giebt außer uns Hunden vielerlei Arten von Geschöpfen ringsumher, arme, geringe, stumme, nur auf gewisse Schreie eingeschränkte Wesen, viele unter uns Hunden studieren sie, haben ihnen Namen gegeben, suchen ihnen zu helfen, sie zu veredeln udgl., mir sind sie, wenn sie mich nicht etwa zu stören versuchen, gleichgültig, ich verwechsle sie, ich sehe über sie hinweg, eines aber ist zu auffallend, als daß es mir hätte entgehen können, wie wenig sie nämlich, mit uns Hunden verglichen, zusammenhalten, wie fremd sie aneinander vorübergehn, wie sie weder ein hohes noch ein niedriges Interesse verbindet, wie vielmehr jedes Interesse sie noch mehr von einander abhält, als es schon der gewöhnliche Zustand der Ruhe mit sich bringt. Wir Hunde dagegen! Man darf doch wohl sagen, daß wir alle förmlich in einem einzigen Haufen leben, alle, so unterschieden wir sonst sind durch die unzähligen und tief gehenden Unterscheidungen, die sich im Laufe der Zeiten ergeben haben. Alle in einem Haufen! Es drängt uns zueinander und nichts kann uns hindern, diesem Drängen genugzutun, alle unsere Gesetze und Einrichtungen, die wenigen die ich noch kenne und die zahllosen, die ich vergessen habe, gehen zurück auf dieses höchste Glück dessen wir fähig sind, das warme Beisammensein. Nun aber das Gegenspiel hiezu. Kein Geschöpf lebt meines Wissens so weithin zerstreut wie wir Hunde, keines hat so viele, gar nicht übersehbare Unterschiede der Klassen, der Arten, der Beschäftigungen, wir die wir zusammenhalten wollen – und immer wieder gelingt es uns trotz allem, in überschwänglichen Augenblicken – gerade wir leben weit von einander getrennt, in eigentümlichen, schon dem Nebenhund oft unverständlichen Berufen, festhaltend an Vorschriften, die nicht die der Hundeschaft sind, ja eher gegen sie gerichtet. Was für schwierige Dinge das sind, Dinge, an die man lieber nicht rührt – ich verstehe auch diesen Standpunkt, verstehe ihn besser als den meinen – und doch Dinge, denen ich ganz und gar verfallen bin. Warum tue ich es nicht wie die andern, lebe einträchtig mit meinem Volke und nehme das was die Eintracht stört, stillschweigend hin, vernachlässige es als kleinen Fehler in der großen Rechnung und bleibe immer zugekehrt dem was glücklich bindet, nicht dem, was uns immer wieder unwiderstehlich aus dem Volkskreis zerrt. Ich erinnere mich an einen Vorfall aus meiner Jugend, ich war damals in einer jener seligen unerklärlichen Aufregungen, wie sie wohl jeder als Kind erlebt, ich war noch ein ganz junger Hund, alles gefiel mir, alles hatte Bezug zu mir, ich glaubte daß große Dinge um mich vorgehn, deren Anführer ich sei, denen ich meine Stimme leihen müsse, Dinge die elend am Boden liegen bleiben müßten, wenn ich nicht für sie lief, für sie meinen Körper schwenkte, nun, Phantasien der Kinder, die mit den Jahren sich verflüchtigen, aber damals waren sie sehr stark, ich war ganz in ihrem Bann und es geschah dann auch freilich etwas Außerordentliches, was den wilden Erwartungen Recht zu geben schien. An sich war es nichts Außerordentliches, später habe ich solche und noch merkwürdigere Dinge oft genug gesehn, aber damals traf es mich mit dem starken ersten unverwischbaren, für vieles folgende richtunggebenden Eindruck. Ich traf nämlich eine kleine Hundegesellschaft, vielmehr ich traf sie nicht, sie kam auf mich zu. Ich war damals lange durch die Finsternis gelaufen, in Vorahnung großer Dinge, eine Vorahnung, die freilich leicht täuschte, denn ich hatte sie immer, war lange durch die Finsternis gelaufen, kreuz und quer, geführt von nichts anderem als dem unbestimmten Verlangen, machte plötzlich Halt in dem Gefühl, hier sei ich am rechten Ort, sah auf und es war überheller Tag, nur ein wenig dunstig, ich begrüßte den Morgen mit wirren Lauten, da – als hätte ich sie heraufbeschworen – traten aus irgendwelcher Finsternis unter Hervorbringung eines entsetzlichen Lärms, wie ich ihn noch nie gehört hatte, sieben Hunde ans Licht. Hätte ich nicht deutlich gesehn daß es Hunde waren und daß sie selbst diesen Lärm mitbrachten, trotzdem ich nicht erkennen konnte, wie sie ihn erzeugten – ich wäre sofort weggelaufen, so aber blieb ich. Damals wußte ich noch fast nichts von der nur dem Hundegeschlecht verliehenen Musikalität, sie war meiner sich erst entwickelnden Aufmerksamkeit entgangen, nur in Andeutungen hatte man mich darauf hinzuweisen versucht, umso überraschender, geradezu niederwerfend waren jene sieben großen Musikkünstler für mich. Sie redeten nicht, sie sangen nicht, sie schwiegen im allgemeinen fast mit einer gewissen Verbissenheit, aber aus dem leeren Raum zauberten sie die Musik empor. Alles war Musik. Das Heben und Niedersetzen ihrer Füße, bestimmte Wendungen des Kopfes, ihr Laufen und ihr Ruhen, die Stellungen, die sie zu einander einnahmen, die reigenmäßigen Verbindungen, die sie mit einander eingiengen, indem etwa einer die Vorderpfoten auf des andern Rücken stützte und sie es dann alle sieben so durchführten, daß der erste die Last aller andern trug, oder indem sie mit ihren nah am Boden hinschleichenden Körpern verschlungene Figuren bildeten und niemals sich irrten, nicht einmal der letzte, der noch ein wenig unsicher war, nicht immer gleich den Anschluß an die andern fand, gewissermaßen im Anschlagen der Melodie manchmal schwankte, aber doch unsicher war nur im Vergleich mit der großartigen Sicherheit der andern und selbst bei viel größerer, ja bei vollkommener Unsicherheit nichts hätte verderben können, wo die andern, große Meister, den Takt unerschütterlich hielten. Aber man sah sie ja kaum, man sah sie ja alle kaum. Sie waren hervorgetreten, man hatte sie innerlich begrüßt als Hunde, sehr beirrt war man zwar von dem Lärm, der sie begleitete, aber es waren doch Hunde, Hunde wie ich und Du, man beobachtete sie gewohnheitsmäßig, wie Hunde denen man auf dem Weg begegnet, man wollte sich ihnen nähern, Grüße tauschen, sie waren auch ganz nah, Hunde, zwar viel älter als ich und nicht von meiner langhaarigen wolligen Art, aber doch auch nicht allzu fremd an Größe und Gestalt, recht vertraut vielmehr, viele von solcher oder ähnlicher Art kannte ich, aber während man noch in solchen Überlegungen befangen war, nahm allmählich die Musik überhand, faßte einen förmlich, zog einen hinweg von diesen wirklichen kleinen Hunden und ganz wider Willen, sich sträubend mit allen Kräften, heulend als würde einem Schmerz bereitet, durfte man sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit der von allen Seiten, von der Höhe, von der Tiefe, von überall her kommenden, den Zuhörer in die Mitte nehmenden, überschüttenden, erdrückenden, über seiner Vernichtung noch, in solcher Nähe, daß es schon Ferne war, kaum hörbar noch Fanfaren blasenden Musik. Und wieder wurde man entlassen, weil man schon zu erschöpft, zu vernichtet, zu schwach war, um noch zu hören, man wurde entlassen und sah die sieben kleinen Hunde ihre Processionen führen, ihre Sprünge tun, man wollte sie, so ablehnend sie aussahn, anrufen, um Belehrung bitten, sie fragen, was sie denn hier machten – ich war ein Kind und glaubte immer und jeden fragen zu dürfen – aber kaum setzte ich an, kaum fühlte ich die gute vertraute hündische Verbindung mit den sieben, war wieder ihre Musik da, machte mich besinnungslos, drehte mich im Kreise herum, als sei ich selbst einer der Musikanten, während ich doch nur ihr Opfer war, warf mich hierhin und dorthin, so sehr ich auch um Gnade bat, und rettete mich schließlich vor ihrer eigenen Gewalt, indem sie mich in ein Gewirr von Hölzern drückte, das in jener Gegend ringsum sich erhob, ohne daß ich es bisher bemerkt hatte, mich jetzt fest umfieng, den Kopf mir niederduckte und mir, mochte dort im Freien die Musik noch donnern, die Möglichkeit gab, ein wenig zu verschnaufen. Wahrhaftig, mehr als über die Kunst der sieben Hunde; – sie war mir unbegreiflich, aber auch gänzlich unanknüpfbar außerhalb meiner Fähigkeiten – wunderte ich mich über ihren Mut, sich dem, was sie erzeugten, völlig und offen auszusetzen und über ihre Kraft, es ohne daß es ihnen das Rückgrat brach, ruhig zu ertragen. Freilich erkannte ich jetzt aus meinem Schlupfloch bei genauerer Beobachtung daß es nicht so sehr Ruhe, als äußerste Anspannung war, mit der sie arbeiteten, diese scheinbar so sicher bewegten Beine zitterten bei jedem Schritt in unaufhörlicher ängstlicher Zuckung, starr wie in Verzweiflung sah einer den andern an, und die immer wieder bewältigte Zunge hing doch gleich wieder schlapp aus den Mäulern. Es konnte nicht Angst wegen des Gelingens sein, was sie so erregte; wer solches wagte, solches zustandebrachte, der konnte keine Angst mehr haben, wovor denn Angst Wer zwang sie denn zu tun, was sie hier taten? Und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, besonders da sie mir jetzt so unverständlich hilfsbedürftig erschienen, und so rief ich durch allen Lärm meine Fragen laut und fordernd hinaus. Sie aber – unbegreiflich! unbegreiflich! – sie antworteten nicht, taten als wäre ich nicht da, Hunde, die auf Hundeanruf gar nicht antworten, ein Vergehn gegen die guten Sitten, das dem kleinsten wie dem größten Hunde unter keinen Umständen verziehen wird. Waren es etwa doch nicht Hunde? Aber wie sollten es denn nicht Hunde sein, hörte ich doch jetzt bei genauerem Hinhorchen sogar leise Zurufe, mit denen sie einander befeuerten, auf Schwierigkeiten aufmerksam machten, vor Fehlern warnten, sah ich doch den letzten kleinsten Hund, dem die meisten Zurufe galten, öfters nach mir hinschielen, so als hätte er viel Lust mir zu antworten, bezwänge sich aber, weil es nicht sein dürfe. Aber warum durfte es nicht sein, warum durfte denn das, was unsere Gesetze bedingungslos immer verlangen, diesmal nicht sein? Das Herz empörte sich in mir, fast vergaß ich die Musik. Diese Hunde hier vergingen sich gegen das Gesetz. Mochten es noch so große Zauberer sein, das Gesetz galt auch für sie, das verstand ich Kind schon ganz genau. Und ich merkte von da aus noch mehr. Sie hatten wirklich Grund zu schweigen, vorausgesetzt daß sie aus Schuldgefühl schwiegen. Denn wie führten sie sich auf, vor lauter Musik hatte ich es bisher nicht bemerkt, sie hatten ja alle Scham von sich geworfen, die Elenden taten das gleichzeitig Lächerlichste und Unanständigste, sie gingen aufrecht auf den Hinterbeinen. Pfui Teufel! Sie entblößten sich und trugen ihre Blöße protzig zur Schau; sie taten sich darauf zugute und wenn sie einmal auf einen Augenblick dem guten Trieb gehorchten und die Vorderbeine senkten, erschraken sie förmlich als sei es ein Fehler, als sei die Natur ein Fehler, hoben wieder schnell die Beine und ihr Blick schien um Verzeihung dafür zu bitten, daß sie in ihrer Sündhaftigkeit ein wenig hatten innehalten müssen. War die Welt verkehrt? Wo war ich? Was war denn geschehn? Hier durfte ich um meines eigenen Bestandes willen nicht mehr zögern, ich machte mich los aus den umklammernden Hölzern, sprang mit einem Satz hervor und wollte zu den Hunden, ich kleiner Schüler mußte Lehrer sein, mußte ihnen begreiflich machen, was sie taten, mußte sie abhalten vor weiterer Versündigung. "So alte Hunde, so alte Hunde! " wiederholte ich mir immerfort. Aber kaum war ich frei und nur noch zwei, drei Sprünge trennten mich von den Hunden, war es wieder der Lärm, der seine Macht über mich bekam. Vielleicht hätte ich in meinem Eifer sogar ihm den ich doch nun schon kannte widerstanden, wenn nicht durch alle seine Fülle, die schrecklich war, aber vielleicht doch zu bekämpfen, ein klarer strenger immer sich gleichbleibender, förmlich aus großer Ferne unverändert ankommender Ton, vielleicht die eigentliche Melodie inmitten des Lärms, geklungen und mich in die Knie gezwungen hätte. Ach, was machten doch diese Hunde für eine betörende Musik. Ich konnte nicht weiter, ich wollte sie nicht mehr belehren, mochten sie weiter die Beine spreizen, Sünden begehn und andere zur Sünde des stillen Anschauens verlocken, ich war ein so kleiner Hund, wer konnte so Schweres von mir verlangen, ich machte mich noch kleiner als ich war, ich winselte, hätten mich damals die Hunde um meine Meinung gefragt, ich hätte ihnen vielleicht recht gegeben. Es dauerte übrigens nicht lange und sie verschwanden mit allem Lärm und allem Licht in der Finsternis, aus der sie gekommen waren.
Wie ich schon sagte: dieser ganze Vorfall enthält nichts Außergewöhnliches, im Verlauf eines langen Lebens begegnet einem mancherlei, was aus dem Zusammenhang genommen und mit den Augen eines Kindes angesehn noch viel erstaunlicher wäre. Überdies kann man es natürlich – wie der treffende Ausdruck lautet – "verreden", so wie alles, dann zeigt sich, daß hier sieben Musiker zusammengekommen waren, um in der Stille des Morgens Musik zu machen, daß ein kleiner Hund sich hinverirrt hatte, ein lästiger Zuhörer, den sie durch besonders schreckliche oder erhabene Musik, leider vergeblich, zu vertreiben suchten. Er störte sie durch Fragen, hätten sie, die schon durch die bloße Anwesenheit des Fremdlings genug gestört waren, auch noch auf diese Belästigung eingehn und sie durch Antworten vergrößern sollen? Und wenn auch das Gesetz befiehlt, jedem zu antworten, ist denn ein solcher winziger hergelaufener Hund überhaupt ein nennenswerter Jemand. Und vielleicht verstanden sie ihn gar nicht, er lallte ja doch wohl seine Fragen recht unverständlich. Oder vielleicht verstanden sie ihn wohl und antworteten in Selbstüberwindung, aber er, der Kleine, der Musik-Ungewohnte, konnte die Antwort von der Musik nicht sondern. Und was die Hinterbeine betrifft, vielleicht gingen sie wirklich ausnahmsweise nur auf ihnen, es ist eine Sünde, wohl! Aber sie waren allein, sieben Freunde, unter Freunden, im vertraulichen Beisammensein, gewissermaßen in den eigenen vier Wänden, gewissermaßen ganz allein, denn Freunde sind doch keine Öffentlichkeit und wo keine Öffentlichkeit ist, bringt sie auch ein kleiner neugieriger Straßenhund nicht hervor, in diesem Fall also: ist es hier nicht so, als wäre nichts geschehn? Ganz so ist es nicht, aber nahezu und die Eltern sollten ihre Kleinen weniger herumlaufen und dafür besser schweigen und das Alter achten lehren.
Ist man so weit, dann ist der Fall erledigt. Freilich was für die Großen erledigt ist, ist es für die Kleinen noch nicht. Ich lief umher, erzählte und fragte, klagte an und forschte und wollte jeden hinziehn zu dem Ort wo alles geschehen war und wollte jedem zeigen, wo ich gestanden hatte und wo die sieben gewesen und wo und wie sie getanzt und musiciert hatten, und wäre jemand mit mir gekommen, statt daß mich jeder abgeschüttelt und ausgelacht hätte, ich hätte dann wohl meine Sündlosigkeit geopfert und mich auch auf die Hinterbeine zu stellen versucht, um alles genau zu verdeutlichen. Nun, einem Kinde nimmt man alles übel, verzeiht ihm aber schließlich auch alles. Ich aber habe dieses kindhafte Wesen behalten und bin darüber ein alter Hund geworden. So wie ich damals nicht aufhörte jenen Vorfall, den ich allerdings heute viel niedriger einschätze, laut zu besprechen, in seine Bestandteile zu zerlegen, an den Anwesenden zu messen ohne Rücksicht auf die Gesellschaft in der ich mich befand, nur immer mit der Sache beschäftigt, die ich lästig fand genau so wie jeder andere, die ich aber – das war der Unterschied – gerade deshalb restlos durch Untersuchung auflösen wollte, um den Blick endlich wieder freizubekommen für das gewöhnliche ruhige glückliche Leben des Tages, ganz so wie damals habe ich, wenn auch mit weniger kindlichen Mitteln – aber sehr groß ist der Unterschied nicht – in der Folgezeit gearbeitet und halte auch heute nicht weiter.
Mit jenem Koncert aber begann es. Ich klage nicht darüber, es ist mein eingeborenes Wesen das hier wirkt und das sich gewiß, wenn das Koncert nicht gewesen wäre, eine andere Gelegenheit gefunden hätte, um durchzubrechen, nur daß es so bald geschah, tat mir früher manchmal leid, es hat mich um einen großen Teil meiner Kindheit gebracht, das glückselige Leben der jungen Hunde, das mancher für sich jahrelang auszudehnen imstande ist, hat für mich nur wenige kurze Monate gedauert. Sei’s darum! Es gibt wichtigere Dinge als die Kindheit. Und vielleicht winkt mir im Alter, erarbeitet durch ein hartes Leben, mehr kindliches Glück, als ein wirkliches Kind zu ertragen die Kraft hätte, die ich dann aber haben werde.
Ich begann damals meine Untersuchungen mit den einfachsten Dingen, an Material fehlte es nicht, leider, der Überfluß ist es, der mich in dunklen Stunden verzweifeln läßt. Ich begann zu untersuchen wovon sich die Hundeschaft nährte. Das ist nun wenn man will natürlich keine einfache Frage, sie beschäftigt uns seit Urzeiten, sie ist der Hauptgegenstand unseres Nachdenkens, zahllos sind die Beobachtungen und Versuche und Ansichten auf diesem Gebiete, es ist eine Wissenschaft geworden, die in ihren ungeheueren Ausmaßen nicht nur über die Fassungskraft des einzelnen, sondern über jene aller Gelehrten insgesamt geht und ausschließlich von niemandem andern als von der gesamten Hundeschaft und selbst von dieser nur seufzend und nicht ganz vollständig getragen werden kann, immer wieder abbröckelt in altem längst besessenem Gut und mühselig ergänzt werden muß, von den Schwierigkeiten und kaum zu erfüllenden Voraussetzungen neuer Forschung ganz zu schweigen. Das alles wende man mir nicht ein, das alles weiß ich, wie nur irgendein Durchschnittshund, es fällt mir nicht ein mich in die wahre Wissenschaft zu mengen, ich habe alle Ehrfurcht vor ihr, die ihr gebürt, aber sie zu vermehren fehlt es mir an Wissen und Fleiß und Ruhe und – nicht zuletzt, besonders seit einigen Jahren – auch an Appetit. Ich schlinge das Essen herunter, wenn ich es finde, aber der geringsten vorgängigen geordneten landwirtschaftlichen Betrachtung ist es mir nicht wert. Mir genügt in dieser Hinsicht der Extrakt aller Wissenschaft, die kleine Regel, mit welcher die Mütter die Kleinen von ihren Brüsten ins Leben entlassen: "Mache alles naß, soviel Du kannst. " Und ist hier nicht wirklich fast alles enthalten? Was hat die Forschung, von unsern Urvätern angefangen, entscheidend Wesentliches dem hinzuzufügen? Einzelnheiten, Einzelnheiten und wie unsicher ist alles, diese Regel aber wird bestehn, solange wir Hunde sind. Sie betrifft unsere Hauptnahrung; gewiß, wir haben noch andere Hilfsmittel, aber im Notfall und wenn die Jahre nicht zu schlimm sind, könnten wir von dieser Hauptnahrung leben, diese Hauptnahrung finden wir auf der Erde, die Erde aber braucht unser Wasser, nährt sich von ihm und nur für diesen Preis gibt sie uns unsere Nahrung, deren Hervorkommen man allerdings, dies ist auch nicht zu vergessen, durch bestimmte Sprüche, Gesänge, Bewegungen beschleunigen kann. Das ist aber meiner Meinung nach alles, von dieser Seite her ist über diese Sache Grundsätzliches nicht mehr zu sagen. Hierin bin ich auch einig mit der großen Mehrzahl der Hundeschaft und von allen in dieser Hinsicht ketzerischen Ansichten wende ich mich streng ab. Wahrhaftig, es geht mir nicht um Besonderheiten, um Rechthaberei, ich bin glücklich, wenn ich mit den Volksgenossen übereinstimmen kann und in diesem Falle geschieht es. Meine eigenen Untersuchungen gehn aber in anderer Richtung. Der Augenschein lehrt mich, daß die Erde, wenn sie nach den Regeln der Wissenschaft besprengt und bearbeitet wird, die Nahrung hergibt undzwar in solcher Qualität, in solcher Menge, auf solche Art, an solchen Orten, zu solchen Stunden, wie es die gleichfalls von der Wissenschaft ganz oder teilweise festgestellten Gesetze verlangen. Das nehme ich hin, meine Frage aber ist: "Woher nimmt die Erde diese Nahrung?" Eine Frage, die man im allgemeinen nicht zu verstehen vorgibt und auf die man mir besten Falls antwortet: "Hast Du nicht genug zu essen, werden wir Dir von dem unsern geben." Man beachte diese Antwort. Ich weiß: Es gehört nicht zu den Vorzügen der Hundeschaft, daß wir Speisen, die wir einmal erlangt haben, zur Verteilung bringen. Das Leben ist schwer, die Erde spröde, die Wissenschaft reich an Erkenntnissen, aber arm genug an praktischen Erfolgen; wer Speise hat behält sie; das ist nicht Eigennutz, sondern das Gegenteil, ist Hundegesetz, ist einstimmiger Volksbeschluß, hervorgegangen aus Überwindung der Eigensucht, denn die Besitzenden sind ja immer in der Minderzahl. Und darum ist jene Antwort: "Hast Du nicht genug zu essen, werden wir Dir von dem unsern geben" eine ständige Redensart, ein Scherzwort, eine Neckerei. Ich habe das nicht vergessen. Aber eine umso größere Bedeutung hatte es für mich, daß man mir gegenüber, damals als ich mich mit meinen Fragen in der Welt umhertrieb, den Spaß beiseite ließ; man gab mir zwar noch immer nichts zu essen – woher hätte man es gleich nehmen sollen? Und wenn man es gerade zufällig hatte, vergaß man natürlich in der Raserei des Hungers jede andere Rücksicht, aber das Angebot meinte man ernst und hie und da bekam ich dann wirklich eine Kleinigkeit, wenn ich schnell genug dabei war sie an mich zu reißen. Wie kam es daß man sich zu mir so besonders verhielt? Mich schonte, mich bevorzugte. Weil ich ein magerer schwacher Hund war, schlecht genährt und zu wenig um Ernährung besorgt? Aber es laufen viel schlecht genährte Hunde herum und man nimmt ihnen selbst die elendste Nahrung vor dem Mund weg, wenn man es kann, oft nicht aus Gier sondern meist aus Grundsatz. Nein, man bevorzugte mich, ich konnte es nicht so sehr mit Einzelnheiten belegen, als daß ich vielmehr den bestimmten Eindruck dessen hatte. Waren es also meine Fragen, über die man sich freute, die man für besonders klug ansah? Nein, man freute sich nicht und hielt sie alle für dumm. Und doch konnten es nur die Fragen sein, die mir die Aufmerksamkeit erwarben. Es war als wolle man lieber das Ungeheuerliche tun, mir den Mund mit Essen zustopfen – man tat es nicht, aber man wollte es – als meine Frage dulden. Aber dann hätte man mich doch besser verjagen können und meine Fragen sich verbitten. Nein, das wollte man nicht, man wollte zwar meine Fragen nicht hören, aber gerade wegen dieser meiner Fragen wollte man mich nicht verjagen. Es war, so sehr ich ausgelacht, als dummes kleines Tier behandelt, hin- und hergeschoben wurde, eigentlich die Zeit meines größten Ansehens, niemals hat sich später etwas derartiges wiederholt, überall hatte ich Zutritt, nichts wurde mir verwehrt, unter dem Vorwand rauher Behandlung wurde mir eigentlich geschmeichelt. Und alles also doch nur wegen meiner Fragen, wegen meiner Ungeduld, wegen meiner Forschungsbegierde. Wollte man mich damit einlullen, ohne Gewalt, fast liebend mich von einem falschen Wege abbringen, von einem Wege, dessen Falschheit doch nicht so über allem Zweifel stand, daß sie erlaubt hätte Gewalt anzuwenden, auch hielt eine gewisse Achtung und Furcht von Gewaltanwendung ab. Ich ahnte schon damals etwas derartiges, heute weiß ich es genau, viel genauer als die welche es damals taten, es ist wahr, man hat mich ablocken wollen von meinem Wege. Es gelang nicht, man erreichte das Gegenteil, meine Aufmerksamkeit verschärfte sich. Es stellte sich mir sogar heraus, daß ich es war, der die andern verlocken wollte und daß mir tatsächlich die Verlockung bis zu einem gewissen Grade gelang. Erst mit der Hilfe der Hundeschaft begann ich meine eigenen Fragen zu verstehn. Wenn ich z. B. fragte: Woher nimmt die Erde diese Nahrung?, kümmerte mich denn dabei, wie es den Anschein haben konnte, die Erde, kümmerten mich etwa der Erde Sorgen? Nicht im geringsten, das lag mir wie ich bald erkannte, völlig fern, mich kümmerten nur die Hunde, gar nichts sonst. Denn was gibt es außer den Hunden? Wen kann man sonst anrufen in der weiten leeren Welt? Alles Wissen, die Gesamtheit aller Fragen und aller Antworten ist in den Hunden enthalten. Wenn man nur dieses Wissen wirksam, wenn man es nur an den hellen Tag bringen könnte, wenn sie nur nicht so unendlich viel mehr wüßten, als sie zugestehn, als sie sich selbst zugestehn. Noch der redseligste Hund ist verschlossener, als es die Orte zu sein pflegen, wo die besten Speisen sind. Man umschleicht den Mithund, man schäumt von Begierde, man prügelt sich selbst mit dem eigenen Schwanz, man fragt, man bittet, man heult, man beißt und erreicht – nun erreicht das, was man auch ohne jede Anstrengung erreichen würde: liebevolles Anhören, freundliche Berührungen, ehrenvolle Beschnupperungen, innige Umarmungen, mein und Dein Heulen mischt sich in eins, alles ist darauf gerichtet, im Entzücken Vergessen zu finden, aber das eine das man vor allem erreichen wollte: Eingeständnis des Wissens, das bleibt versagt, auf diese Bitte, ob stumm, ob laut, antworten besten Falls, wenn man die Verlockung schon aufs äußerste getrieben hat, nur stumpfe Mienen, schiefe Blicke, verhängte, trübe Augen. Es ist nicht viel anders, als es damals war, da ich als Kind die Musikerhunde anrief und sie schwiegen. Nun könnte man sagen: "Du beschwerst Dich über Deine Mithunde, über ihre Schweigsamkeit hinsichtlich der entscheidenden Dinge, Du behauptest, sie wüßten mehr als sie eingestehn, mehr als sie im Leben gelten lassen wollen und dieses Verschweigen, dessen Grund und Geheimnis sie natürlich auch noch mitverschweigen, vergifte das Leben, mache es Dir unerträglich, Du müssest es ändern oder es verlassen, mag sein, aber Du bist doch selbst ein Hund, hast auch das Hunde-Wissen, nun, sprich es aus, nicht nur in Form der Frage, sondern als Antwort. Wenn Du es aussprichst, wer wird Dir widerstehen? Der große Chor der Hundeschaft wird einfallen, als hätte er darauf gewartet. Dann hast Du Wahrheit, Klarheit, Eingeständnis soviel Du nur willst. Das Dach dieses niedrigen Lebens, dem Du so Schlimmes nachsagst, wird sich öffnen und wir werden alle, Hund bei Hund, aufsteigen in die hohe Freiheit. Und sollte das Letzte nicht gelingen, sollte es schlimmer werden als bisher, sollte die ganze Wahrheit unerträglicher sein als die halbe, sollte sich bestätigen daß die Schweigenden als Erhalter des Lebens im Rechte sind, sollte aus der leisen Hoffnung die wir jetzt noch haben, völlige Hoffnungslosigkeit werden, des Versuches ist das Wort doch wert, da Du, so wie Du leben darfst nicht leben willst. Nun also, warum machst Du den andern ihre Schweigsamkeit zum Vorwurf und schweigst selbst" Leichte Antwort: Weil ich ein Hund bin. Im Wesentlichen genau so wie die andern fest verschlossen, Widerstand leistend den eigenen Fragen, hart aus Angst. Frage ich denn, genau genommen, zumindest seitdem ich erwachsen bin, die Hundeschaft deshalb, daß sie mir antwortet? Habe ich so törichte Hoffnungen? Sehe ich die Fundamente unseres Lebens, ahne ihre Tiefe, sehe die Arbeiter beim Bau, bei ihrem finstern Werk und erwarte noch immer, daß auf meine Fragen hin alles dies beendigt, zerstört, verlassen wird? Nein, das erwarte ich wahrhaftig nicht mehr. Mit meinen Fragen hetze ich nur noch mich selbst, will mich anfeuern durch das Schweigen, das allein ringsum mir noch antwortet.' Wie lange wirst Du es ertragen, daß die Hundeschaft, wie Du Dir durch Deine Forschungen immer mehr zu Bewußtsein bringst, schweigt und immer schweigen wird? Wie lange wirst Du es ertragen, so lautet über allen Einzelfragen meine eigentliche Lebensfrage; sie ist nur an mich gestellt und belästigt keinen andern. Leider kann ich sie leichter beantworten als die Einzelfragen: Ich werde es voraussichtlich aushalten bis zu meinem natürlichen Ende, den unruhigen Fragen widersteht immer mehr die Ruhe des Alters. Ich werde wahrscheinlich schweigend, von Schweigen umgeben, friedlich sterben und ich sehe dem nahezu gefaßt entgegen. Ein bewunderungswürdig starkes Herz, eine vorzeitig nicht abzunützende Lunge sind uns Hunden wie aus Bosheit mitgegeben, wir widerstehen allen Fragen, selbst den eigenen, Bollwerk des Schweigens, das wir sind.
Immer mehr in letzter Zeit überdenke ich mein Leben, suche den entscheidenden alles verschuldenden Fehler, den ich vielleicht begangen habe und kann ihn nicht finden. Und ich muß ihn doch begangen haben, denn hätte ich ihn nicht begangen und hätte trotzdem durch die redliche Arbeit eines langen Lebens, das was ich wollte nicht erreicht, so wäre bewiesen, daß das was ich wollte unmöglich war und völlige Hoffnungslosigkeit würde daraus folgen. Sieh das Werk Deines Lebens! Zuerst die Untersuchungen hinsichtlich der Frage: Woher nimmt die Erde die Nahrung für uns. Ein junger Hund, im Grunde natürlich gierig und lebenslustig, verzichtete ich auf alle Genüsse, wich allen Vergnügungen im Bogen aus, vergrub vor Verlockungen den Kopf zwischen den Beinen und machte mich an die Arbeit. Es war keine Gelehrtenarbeit, weder was die Gelehrsamkeit, noch was die Methode, noch was die Absicht betrifft. Das waren wohl Fehler, aber entscheidend können sie nicht gewesen sein. Ich habe wenig gelernt, denn ich kam frühzeitig von der Mutter fort, gewöhnte mich bald an Selbstständigkeit, führte ein freies Leben und allzufrühe Selbstständigkeit ist dem systematischen Lernen feindlich. Aber ich habe viel gesehen, gehört, mit vielen Hunden der verschiedensten Arten und Berufe gesprochen und alles wie ich glaube nicht schlecht aufgefaßt und die Einzelbeobachtungen nicht schlecht verbunden, das hat ein wenig die Gelehrsamkeit ersetzt, außerdem aber ist Selbständigkeit, mag sie für das Lernen ein Nachteil sein, für eigene Forschung ein großer Vorzug. Sie war in meinem Fall umso nötiger, als ich nicht die eigentliche Methode der Wissenschaft befolgen konnte, nämlich die Arbeiten der Vorgänger zu benützen und mit den zeitgenössischen Forschern mich zu verbinden. Ich war völlig auf mich allein angewiesen, begann mit dem allerersten Anfang und mit dem für die Jugend beglückenden, für das Alter dann aber äußerst niederdrückenden Bewußtsein, daß der zufällige Schlußpunkt den ich setzen werde, auch der endgültige sein müsse. War ich wirklich so allein mit meinen Forschungen, jetzt und seit jeher? Ja und nein. Es ist unmöglich, daß nicht immer und auch heute einzelne Hunde hier und dort in meiner Lage waren und sind. So schlimm kann es mit mir nicht stehn. Ich bin kein Haar breit außerhalb des Hundewesens. Jeder Hund hat wie ich den Drang zu fragen und ich habe wie jeder Hund den Drang zu schweigen. Jeder hat den Drang zu fragen. Hätte ich denn sonst durch meine Fragen auch nur die leichten Erschütterungen erreichen können, die mir oft mit Entzücken, übertriebenem Entzücken allerdings zu sehen vergönnt war. Und daß ich den Drang zu schweigen habe, bedarf leider keines besondern Beweises. Ich bin also grundsätzlich nicht anders als jeder andere Hund, darum wird mich trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Abneigungen im Grunde jeder anerkennen und ich werde es mit jedem Hund nicht anders tun. Nur die Mischung der Elemente ist verschieden, ein persönlich sehr großer, volklich bedeutungsloser Unterschied. Und nun sollte die Mischung dieser immer vorhandenen Elemente innerhalb der Vergangenheit und Gegenwart niemals ähnlich der meinen ausgefallen sein und wenn man meine Mischung unglücklich nennen will, nicht auch noch viel unglücklicher? Das wäre gegen alle übrige Erfahrung. In den sonderbarsten Berufen sind wir Hunde beschäftigt, Berufe, an die man gar nicht glauben würde, wenn man nicht die vertrauenswürdigsten Nachrichten darüber hätte. Ich denke hier am liebsten an das Beispiel der Lufthunde. Als ich zum erstenmal von einem hörte, lachte ich, ließ es mir auf keine Weise einreden. Wie? Es sollte einen Hund von allerkleinster Art geben, nicht viel größer als mein Kopf, auch im hohen Alter nicht größer und dieser Hund, natürlich schwächlich, dem Anschein nach ein künstliches, unreifes, übersorgfältig frisiertes Gebilde, unfähig einen ehrlichen Sprung zu tun, dieser Hund sollte wie man erzählte, meistens hoch in der Luft sich fortbewegen, dabei aber keine sichtbare Arbeit machen sondern ruhn. Nein, solche Dinge mir einreden wollen, das hieß doch die Unbefangenheit eines jungen Hundes gar zu sehr ausnützen, glaubte ich. Aber kurz darauf hörte ich von anderer Seite von einem andern Lufthund erzählen. Hatte man sich vereinigt mich zum Besten zu halten? Dann aber sah ich die Musikerhunde und von dieser Zeit an hielt ich alles für möglich, kein Vorurteil beschränkte meine Fassungskraft, den unsinnigsten Gerüchten ging ich nach, verfolgte sie soweit ich konnte, das Unsinnigste erschien mir in diesem unsinnigen Leben wahrscheinlicher als das Sinnvolle und für meine Forschung besonders ergiebig. So auch die Lufthunde. Ich erfuhr vielerlei über sie, es gelang mir zwar bis heute keinen zu sehn, aber von ihrem Dasein bin ich schon längst fest überzeugt und in meinem Weltbild haben sie ihren wichtigen Platz. Wie meistens so auch hier ist es natürlich nicht die Kunst, die mich vor allem nachdenklich macht. Es ist wunderbar, wer kann das leugnen, daß diese Hunde in der Luft zu schweben imstande sind, im Staunen darüber bin ich mit der Hundeschaft einig. Aber viel wunderbarer ist für mein Gefühl die Unsinnigkeit, die schweigende Unsinnigkeit dieser Existenzen. Im Allgemeinen wird sie gar nicht begründet, sie schweben in der Luft und dabei bleibt es, das Leben geht weiter seinen Gang, hie und da spricht man von Kunst und Künstlern, das ist alles. Aber warum, grundgütige Hundeschaft, warum nur schweben diese Hunde? Was für einen Sinn hat ihr Beruf? Warum ist kein Wort der Erklärung von ihnen zu bekommen? Warum schweben sie dort oben, lassen die Beine, den Stolz des Hundes, verkümmern, sind getrennt von der nährenden Erde, säen nicht und ernten doch, werden angeblich sogar auf Kosten der Hundeschaft besonders gut genährt. Ich kann mir schmeicheln, daß ich durch meine Fragen in diese Dinge doch ein wenig Bewegung gebracht habe. Man beginnt zu begründen, eine Art Begründung zusammenzuhaspeln, man beginnt und wird allerdings auch über diesen Beginn nicht hinausgehn. Aber etwas ist es doch. Und es zeigt sich dabei zwar nicht die Wahrheit – niemals wird man soweit kommen – aber doch etwas von der tiefen Verwurzelung der Lüge. Alle unsinnigen Erscheinungen unseres Lebens und die unsinnigsten ganz besonders lassen sich nämlich begründen. Nicht vollständig natürlich – das ist der teuflische Witz – aber um sich gegen peinliche Fragen zu schützen, reichts hin. Die Lufthunde wieder als Beispiel genommen. Sie sind nicht hochmütig, wie man zunächst glauben könnte, sie sind vielmehr der Mithunde besonders bedürftig, versucht man sich in ihre Lage zu versetzen versteht mans. Sie müssen ja wenn sie es schon nicht offen tun können – das wäre Verletzung der Schweigepflicht – so doch auf irgendeine andere Art für' ihre Lebensweise Verzeihung zu erlangen suchen oder wenigstens von ihr ablenken, sie vergessen machen, sie tun das, wie man mir erzählt, durch eine fast unerträgliche Geschwätzigkeit. Immerfort haben sie zu erzählen, teils von ihren philosophischen Überlegungen mit denen sie sich, da sie auf körperliche Anstrengung völlig verzichtet haben, fortwährend beschäftigen können, teils von den Beobachtungen, die sie von ihrem erhöhten Standort aus machen. Und trotzdem sie sich, was bei einem solchen Lotterleben selbstverständlich ist, durch Geisteskraft nicht sehr auszeichnen und ihre Philosophie so wertlos ist wie ihre Beobachtungen und die Wissenschaft kaum etwas davon verwenden kann und überhaupt auf so jämmerliche Hilfsquellen nicht angewiesen ist, trotzdem wird man, wenn man fragt, was die Lufthunde überhaupt sollen, immer wieder zur Antwort bekommen, daß sie zur Wissenschaft viel beitragen. "Das ist richtig", sagt man darauf, "aber ihre Beiträge sind wertlos und lästig." Die weitere Antwort ist Achselzucken, Ablenkung, Ärger oder Lachen, und in einem Weilchen, wenn man wieder fragt, erfährt man doch wiederum, daß sie zur Wissenschaft beitragen, und schließlich, wenn man nächstens gefragt wird und sich nicht sehr beherrscht, antwortet man das Gleiche. Und vielleicht ist es auch gut, nicht allzu hartnäckig zu sein und sich zu fügen, die schon bestehenden Lufthunde nicht in ihrer Lebensberechtigung anzuerkennen, was unmöglich ist, aber doch zu dulden. Aber mehr darf man nicht verlangen, das ginge zu weit und man verlangt es doch. Man verlangt die Duldung immer neuer Lufthunde, die heraufkommen. Man weiß gar nicht genau woher sie kommen. Vermehren sie sich durch Fortpflanzung? Haben sie denn noch die Kraft dazu, sie sind ja nicht viel mehr als ein schönes Fell, was soll sich hier fortpflanzen? Und wenn das Unwahrscheinliche möglich wäre, wann sollte es geschehn? Immer sieht man sie doch allein, selbstgenügsam oben in der Luft und wenn sie einmal zu laufen sich herablassen, geschieht es nur ein kleines Weilchen lang, paar gezierte Schritte und immer wieder nur streng allein und in angeblichen Gedanken, von denen sie sich, selbst wenn sie sich anstrengen, nicht losreißen können, wenigstens behaupten sie das. Wenn sie sich aber nicht fortpflanzen, wäre es denkbar, daß sich Hunde finden, welche freiwillig das ebenerdige Leben aufgeben, freiwillig Lufthunde werden und um den Preis der Bequemlichkeit und einer gewissen Kunstfertigkeit dieses öde Leben dort auf den Kissen wählen? Das ist nicht denkbar, weder Fortpflanzung noch freiwilliger Anschluß ist denkbar. Die Wirklichkeit aber zeigt, daß es doch immer wieder neue Lufthunde gibt; daraus ist zu schließen, daß mögen auch die Hindernisse unserem Verstande unüberwindbar scheinen eine einmal vorhandene Hundeart sei sie auch noch so sonderbar nicht ausstirbt, zumindest nicht leicht, zumindest nicht ohne daß in jeder Art etwas wäre, das sich lange erfolgreich wehrt. Muß ich das, wenn es für eine so abseitige sinnlose äußerlich allersonderbarste, lebensunfähige Art wie die der Lufthunde gilt, nicht auch für meine Art annehmen? Dabei bin ich äußerlich gar nicht sonderbar, gewöhnlicher Mittelstand der wenigstens hier in der Gegend sehr häufig ist, durch nichts besonders hervorragend, durch nichts besonders verächtlich, in meiner Jugend und noch teilweise im Mannesalter, solange ich mich nicht vernachlässigte und viel Bewegung machte, war ich sogar ein recht hübscher Hund, besonders meine Vorderansicht wurde gelobt, die schlanken Beine, die schöne Kopfhaltung, aber auch mein grau-weiß-gelbes, nur in den Haarspitzen sich ringelndes Fell war sehr gefällig, das alles ist nicht sonderbar, sonderbar ist nur mein Wesen, aber auch dieses, wie ich niemals außer Acht lassen darf, im allgemeinen Hundewesen wohl begründet. Wenn nun sogar der Lufthund nicht allein bleibt, hier und dort in der großen Hundewelt immer wieder sich einer findet und sie sogar aus dem Nichts immer wieder neuen Nachwuchs holen dann kann auch ich die Zuversicht haben, daß ich nicht verlassen bin. Freilich ein besonderes Schicksal müssen meine Artgenossen haben und ihr Dasein wird mir niemals sichtbar helfen, schon deshalb nicht weil ich sie kaum je erkennen werde. Wir sind die welche das Schweigen drückt, welche es förmlich aus Lufthunger durchbrechen wollen, den andern scheint im Schweigen wohl zu sein, zwar hat es nur diesen Anschein, so wie bei den Musikhunden, die scheinbar ruhig musicierten, in Wirklichkeit aber sehr aufgeregt waren, aber dieser Anschein ist stark, man versucht ihm beizukommen, er spottet jedes Angriffs. Wie helfen sich nun meine Artgenossen? Wie sehen ihre Versuche, dennoch zu leben, aus? Das mag verschieden sein. Ich habe es mit meinen Fragen versucht, solange ich jung war. Ich könnte mich also vielleicht an die halten, welche viel fragen und da hätte ich dann meine Artgenossen. Ich habe auch das eine Zeitlang mit Selbstüberwindung versucht, mit Selbstüberwindung, denn mich kümmern ja vor allem die welche antworten sollen, die welche mir immerfort mit Fragen, die ich meist nicht beantworten kann, dazwischenfahren, sind mir widerwärtig. Und dann wer fragt denn nicht gern solange er jung ist, wie soll ich aus den vielen Fragern die richtigen herausfinden. Eine Frage klingt wie die andere, auf die Absicht kommt es an, die aber ist verborgen, oft auch dem Frager. Und überhaupt, das Fragen ist ja eine Eigentümlichkeit der Hundeschaft, alle fragen durcheinander, es ist, als sollte damit die Spur der richtigen Frager verwischt werden. Nein unter den Fragern, den Jungen, finde ich meine Artgenossen nicht und unter den Schweigern, den Alten, zu denen ich jetzt gehöre, ebensowenig. Aber was sollen denn die Fragen, ich bin ja mit ihnen gescheitert, wahrscheinlich sind meine Genossen viel klüger als ich und wenden ganz andere vortreffliche Mittel an, um dieses Leben zu ertragen, Mittel freilich, die wie ich aus eigenem hinzufüge, vielleicht ihnen zur Not helfen, beruhigen, einschläfern, artverwandelnd wirken, aber in der Allgemeinheit ebenso ohnmächtig sind, wie die meinen, denn soviel ich auch ausschaue, einen Erfolg sehe ich nicht. Ich fürchte, an allem andern werde ich meine Artgenossen eher erkennen, als am Erfolg. Wo sind dann aber meine Artgenossen? Ja das ist die Klage, das ist sie eben. Wo sind sie? Überall und nirgends. Vielleicht ist es mein Nachbar, drei Sprünge weit von mir, wir rufen einander oft zu, er kommt auch zu mir herüber, ich zu ihm nicht. Ist er mein Artgenossen Ich weiß nicht, ich erkenne zwar nichts dergleichen an ihm, aber möglich ist es. Möglich ist es, aber doch ist nichts unwahrscheinlicher; wenn er fern ist, kann ich zum Spiel mit Zuhilfenahme aller Phantasie manches mich verdächtig Anheimelnde an ihm herausfinden, steht er dann aber vor mir, sind alle meine Erfindungen zum Lachen. Ein alter Hund, noch etwas kleiner als ich, der ich kaum Mittelgröße habe, braun, kurzhaarig, mit müde hängendem Kopf, mit schlürfenden Schritten, das linke Hinterbein schleppt er überdies infolge einer Krankheit ein wenig nach. So nah wie mit ihm verkehre ich schon seit lange mit niemandem, ich bin froh daß ich ihn doch noch leidlich ertrage und wenn er fortgeht schreie ich ihm die freundlichsten Dinge nach, freilich nicht aus Liebe, sondern zornig auf mich, weil ich ihn, wenn ich ihm nachsehe, doch wieder nur ganz abscheulich finde, wie er sich wegschleicht mit dem nachschleppenden Fuß und dem viel zu niedrigen Hinterteil. Manchmal ist mir als wollte ich mich selbst verspotten, wenn ich ihn in Gedanken meinen Genossen nenne. Auch in unsern Gesprächen verrät er nichts von irgendeiner Genossenschaft, zwar ist er klug und, für unsere Verhältnisse hier, gebildet genug und ich könnte viel von ihm lernen, aber suche ich Klugheit und Bildung? Wir unterhalten uns gewöhnlich über örtliche Fragen und ich staune dabei, durch meine Einsamkeit in dieser Hinsicht hellsichtiger gemacht, wieviel Geist selbst für einen gewöhnlichen Hund, selbst bei durchschnittlich nicht allzu ungünstigen Verhältnissen nötig ist, um sein Leben zu fristen und sich vor den größten üblichen Gefahren zu schützen. Die Wissenschaft gibt zwar die Regeln, aber sie auch nur von der Ferne und in den gröbsten Hauptzügen zu verstehn ist gar nicht leicht und wenn man sie verstanden hat, kommt erst das eigentlich Schwere, sie nämlich auf die örtlichen Verhältnisse anzuwenden, hier kann kaum jemand helfen, fast jede Stunde gibt neue Aufgaben und jedes neue Fleckchen Erde seine besondern; daß er für die Dauer irgendwo eingerichtet ist und daß sein Leben nun gewissermaßen von selbst verläuft, kann niemand von sich behaupten, nicht einmal ich, dessen Bedürfnisse sich förmlich von Tag zu Tag verringern. Und alle diese unendliche Mühe – zu welchem Zweck? Doch nur um sich immer weiter zu vergraben im Schweigen und um niemals und von niemand mehr herausgeholt werden zu können. Man rühmt oft den allgemeinen Fortschritt der Hundeschaft durch die Zeiten und meint damit wohl hauptsächlich den Fortschritt der Wissenschaft. Gewiß, die Wissenschaft schreitet fort, das ist unaufhaltsam, sie schreitet sogar mit Beschleunigung fort, immer schneller, aber was ist daran zu rühmen? Es ist so wie wenn man jemanden deshalb rühmen wollte, weil er mit zunehmenden Jahren älter wird und infolgedessen immer schneller der Tod sich nähert. Das ist ein natürlicher und überdies ein häßlicher Vorgang an dem ich nichts zu rühmen finde. Ich sehe nur Verfall, wobei ich aber nicht meine, daß frühere Generationen im Wesen besser waren, sie waren nur jünger, das war ihr großer Vorzug, ihr Gedächtnis war noch nicht so überlastet wie das heutige, es war noch leichter sie zum Sprechen zu bringen und wenn es auch niemandem gelungen ist, die Möglichkeit war größer, diese größere Möglichkeit ist ja das, was uns beim Anhören jener alten, doch eigentlich einfältigen Geschichten so erregt. Hie und da hören wir ein andeutendes Wort und möchten fast aufspringen, fühlten wir nicht die Last der Jahrhunderte auf uns. Nein, was ich auch gegen meine Zeit einzuwenden habe, die früheren Generationen waren nicht besser als die neueren, ja in gewissem Sinn waren sie viel schlechter und schwächer. Die Wunder gingen freilich auch damals nicht frei über die Gassen zum beliebigen Einfangen, aber die Hunde waren, ich kann es nicht anders ausdrücken, noch nicht so hündisch wie heute, das Gefüge der Hundeschaft war noch locker, das wahre Wort hätte damals noch eingreifen, den Bau bestimmen, umstimmen, nach jedem Wunsche ändern, in sein Gegenteil verkehren können und jenes Wort war da, war zumindest nahe, schwebte auf der Zungenspitze, jeder konnte es erfahren, wo ist es heute hingekommen, heute könnte man schon ins Gekröse greifen und würde es nicht finden. Unsere Generation ist vielleicht verloren, aber sie ist unschuldiger, als die damalige. Das Zögern meiner Generation kann ich verstehn, es ist ja auch gar kein Zögern mehr, es ist das Vergessen eines vor tausend Nächten geträumten und tausendmal vergessenen Traumes, wer will uns gerade wegen des tausendsten Vergessens zürnen? Aber auch das Zögern unserer Urväter glaube ich zu verstehn, wir hätten wahrscheinlich nicht anders gehandelt, fast möchte ich sagen, wohl uns, daß nicht wir es waren, die die Schuld auf uns laden mußten, daß wir vielmehr in einer schon von anderen verfinsterten Welt in fast schuldlosem Schweigen dem Tode zueilen dürfen. Als unsere Urväter abirrten, dachten sie wohl kaum an ein endloses Irren, sie sahen ja förmlich noch' den Kreuzweg, es war leicht wann immer zurückzukehren und wenn sie zurückzukehren zögerten, so nur deshalb, weil sie noch eine kurze Zeit sich des Hundelebens freuen wollten, es war noch gar kein eigentliches Hundeleben und schon schien es ihnen berauschend schön, wie mußte es erst später werden, wenigstens noch ein kleines Weilchen später und so irrten sie weiter. Sie wußten nicht, was wir bei Betrachtung des Geschichtsverlaufs ahnen können, daß die Seele sich früher wandelt, als das Leben und daß sie, als sie das Hundeleben zu freuen begann, schon eine recht althündische Seele haben mußten und gar nicht mehr so nahe dem Ausgangspunkt waren, wie ihnen schien oder wie ihr in allen Hundefreuden schwelgendes Auge sie glauben machen wollte. Wer kann heute noch von Jugend sprechen. Sie waren die eigentlichen jungen Hunde, aber ihr einziger Ehrgeiz war leider darauf gerichtet alte Hunde zu werden, etwas was ihnen freilich nicht mißlingen konnte, wie alle folgenden Generationen beweisen und unsere, die letzte, am besten. – Über alle diese Dinge rede ich natürlich mit meinem Nachbar nicht, aber ich muß oft an sie denken, wenn ich ihm gegenüber sitze, diesem typisch alten Hund, oder die Schnauze in sein Fell vergrabe, das schon einen Anhauch jenes Geruches hat, den abgezogene Felle haben. Es wäre sinnlos, über jene Dinge zu reden, übrigens mit ihm wie mit jedem andern. Ich weiß wie das Gespräch verlaufen würde. Er hätte einige kleine Einwände hie und da, schließlich würde er zustimmen – Zustimmung ist die beste Waffe – und die Sache wäre begraben, warum sie also überhaupt erst aus ihrem Grab bemühn? Und trotz allem, es gibt doch vielleicht eine über bloße Worte hinausgehende tiefere Übereinstimmung mit meinem Nachbar. Ich kann nicht aufhören das zu behaupten, trotzdem ich keine Beweise dafür habe und vielleicht dabei nur einer einfachen Täuschung unterliege, weil er eben seit langem der einzige ist mit dem ich verkehre und ich mich also an ihn halten muß. "Bist Du doch vielleicht mein Genosse? Auf Deine Art? Und schämst Dich, weil Dir alles mißlungen ist? Sieh, mir ist es ebenso gegangen. Wenn ich allein bin, heule ich darüber, komm, zu zweit ist es süßer." So denke ich manchmal und sehe ihn dabei fest an. Er senkt dann den Blick nicht, aber auch zu entnehmen ist ihm nichts, stumpf sieht er mich an und wundert sich warum ich schweige und unsere Unterhaltung unterbrochen habe. Aber vielleicht ist gerade dieser Blick seine Art zu fragen und ich enttäusche ihn, so wie er mich enttäuscht. In meiner Jugend hätte ich ihn, wenn mir damals nicht andere Fragen wichtiger gewesen wären und ich allein mir reichlich genügt hätte, vielleicht laut gefragt, hätte eine matte Zustimmung bekommen, also weniger als heute, da er schweigt. Aber schweigen nicht alle ebenso? Was hindert mich zu glauben, daß alle meine Genossen sind, daß ich nicht nur hie und da einen Mitforscher hatte, der mit seinen winzigen Ergebnissen versunken und vergessen ist und zu dem ich auf keine Weise mehr gelangen kann durch das Dunkel der Zeiten oder das Gedränge der Gegenwart:, daß ich vielmehr in allen seitjeher Genossen habe, die sich alle bemühn nach ihrer Art, alle erfolglos nach ihrer Art, alle schweigend oder listig plappernd nach ihrer Art, wie es diese hoffnungslose Forschung mit sich bringt. Dann hätte ich mich aber auch gar nicht absondern müssen, hätte ruhig unter den andern bleiben können, hätte nicht wie ein unartiges Kind durch die Reihen der Erwachsenen mich hinausdrängen müssen, die ja ebenso hinaus wollen wie ich und an denen mich nur ihr Verstand beirrt, der ihnen sagt, daß niemand hinauskommt und daß alles Drängen töricht ist.
Solche Gedanken sind allerdings deutlich die Wirkung meines Nachbars, er verwirrt mich, er macht mich ganz melancholisch; und ist für sich fröhlich genug, wenigstens höre ich ihn, wenn er in seinem Bereich ist, schreien und singen, daß es mir lästig ist. Es wäre gut auch auf diesen letzten Verkehr zu verzichten, nicht vagen Träumereien nachzugehn, wie sie jeder Hundeverkehr, so abgehärtet man zu sein glaubt unvermeidlich erzeugt und die kleine Zeit die mir bleibt, ausschließlich für meine Forschungen zu verwenden. Ich werde wenn er
(Die Fortsetzung dieses Fragments ist auf dem nächsten Textträger)

