 |
 |
|||
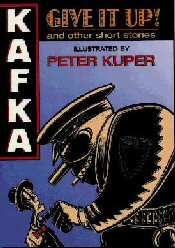
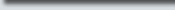
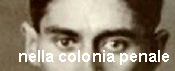
"… noch nicht hier" (II, 28)
(Fortsetzung des vorigen Textträgers)
noch nicht hier und der Fremde hatte es deshalb verhältnismäßig leicht zu kommandieren. Je denfalls saß er nun dem Hungerkünstler so nahe als es überhaupt möglich war und hatte sogar die Keckheit, welche selbst die Saaldiener wieder zu einem allerdings schon nach den ersten Schritten wieder aufgegebenen Vormarsch veranlaßte, aus dem Käfig sich einen Strohhalm zu langen und den Hungerkünstler, der überhaupt nicht völlig wach geworden zu sein schien und wieder schlummerte, ein wenig unter dem Kinn zu kitzeln. "Nun", sagte er, "willst Du nicht ein wenig aufwachen wenn Besuch da ist?" Das war ein recht rohes Benehmen, wenn man auch dem Mann die freilich vergeblich bleibende Anstrengung ansah, den Hungerkünstler zart, gewissermaßen väterlich oder freundschaftlich zu behandeln. Besonders deutlich war dies, als er jetzt dem nun völlig erwachten und ihn mit seinen großen schwarzen Augen ängstlich ansehenden Hungerkünstler lächelnd zunickte. "Ja", sagte er, "ich bin es, der alte, Dir und vielleicht nur Dir allein wohlgesinnte Menschenfresser. Einen kleinen Besuch will ich Dir machen, mich erholen an Deinem Anblick, die Nerven ein wenig ausruhn lassen von dem lästigen Volk." "Du bist ein Menschenfresser?" fragte der Hungerkünstler und drückte die Hand an die Stirn als suche er sich an etwas zu erinnern. "Du hast mich vergessen?" sagte der Menschenfresser, ein wenig gekränkt und noch mehr verwundert als gekränkt, "ist es denn möglich? Du weißt nicht mehr wie wir mit einander spielten? Wie Dich meine roten Haare freuten? Wie Du sie zu Zöpfchen geflochten und gebunden hast? Ähnlich wie diese?" Und er nahm den Hut ab und das Haar quoll wie lebendig, wie in einer tropischen Fülle, zum Teil geflochten, zum Teil in seiner wilden Ursprünglichkeit hervor. Sein Kopf war mächtig, aber die Haarmasse war so groß als gehöre sie einem noch viel mächtigeren Kopf an, der Kopf erschien klein unter ihr. Dabei aber hatte der Anblick nichts Lächerliches, sondern war erschreckend, es war als zeige dies übermenschliche Haar auch übermenschliche Gelüste an und die Kräfte, sie zu verwirklichen.
Ich bin in die Fremde gegangen und habe mich bei einem fremden Volk einquartiert. Ich habe dort meinen Mantel an den Nagel gehängt, niemand hat sich um mich gekümmert. Man läßt mich gewähren, man weiß daß keine Gefahr von mir droht. Was will der Einzelne gegenüber der großen Menge. Ich bin gekommen und man läßt mir für mein Kommen die Verantwortung. Ich hatte wohl kommen müssen, ich hatte eine Zuflucht gebraucht, das ist die stillschweigende Annahme. Die weitere Annahme ist daß ich diese Zuflucht nicht finden werde, man sieht mir an, wie wenig ich mich anzupassen verstehe, die Verhältnisse sind mir wohl gar zu fremdartig, ich bin nicht am rechten Ort. Aber das alles läßt man mich kaum fühlen, man ist auch zusehr mit den eigenen Angelegenheiten beschäftigt, vielleicht könnte ich bei diesen Angelegenheiten mit meinen besondern Erfahrungen und Fähigkeiten nützlich eingreifen, aber ich wage mich nicht einzumischen und man wagt nicht mich heranzuziehn, die Gefahr, daß ich bei meiner Fremdheit etwas verderben könnte, ist doch gar zu groß.
abzuschütteln, in gewöhnlichen Zeiten ruhig ertrug, in der Trunkenheit aber doch dagegen rebellierte. Und wenn ich natürlich auch die Intimitäten die ich unter solchen Umständen erfuhr, keinesfalls in der Zeitung preisgeben wollte, hatte ich doch schon die Umrisse eines Artikels im Kopfe fertig, in welchem ich darstellen wollte, daß überall, wo sich menschliche Größe unverhüllt zeigen kann, also vor allem im Sport, sich auch gleich Gesindel herandrängt und rücksichtslos, ohne überhaupt ernstlich zu dem Helden aufzublicken, nur über die eigenen Interessen gebeugt seinen Vorteil sucht, und bestenfalls ihr Verhalten damit entschuldigt, daß es zum Nutzen der Allgemeinheit geschehe.
Unsere Sängerin heißt Josefine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesanges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt, was umso höher zu bewerten ist, als unser Geschlecht im Ganzen Musik nicht liebt. Stiller Frieden ist uns im allgemeinen die liebste Musik, unser Leben ist schwer, wir können uns auch wenn wir einmal alle Tagessorgen abzuschütteln versucht haben, nicht mehr zu solchen unserem sonstigen Leben so fernen Dingen erheben wie es die Musik ist. Doch beklagen wir es nicht sehr, nicht einmal so weit – dies ist meine persönliche Ansicht – kommen wir, eine gewisse praktische Schlauheit, die wir freilich auch äußerst dringend brauchen, halten wir für unsern größten Vorzug und mit dem Lächeln dieser Schlauheit pflegen wir uns über alles hinwegzutrösten, auch wenn wir z. B. – was aber nicht geschieht – einmal das Verlangen nach dem Glück haben sollten, das von der Musik vielleicht ausgeht. Nur Josefine macht eine Ausnahme, sie liebt die Musik und weiß sie auch zu vermitteln, sie ist die einzige; mit ihrem Hingang wird die Musik – wer weiß für wie lange – aus unserem Leben verschwinden. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es sich mit dieser Musik eigentlich verhält. Wir sind doch ganz unmusikalisch, wie kommt es daß wir Josefinens Gesang doch verstehn oder, da Josefine das Verständnis leugnet, zu verstehen glauben. Die einfachste Antwort wäre daß die Schönheit dieses Gesanges so groß ist, daß auch der ihr feindlichste Sinn hier nicht widerstehen kann, aber diese Antwort ist nicht befriedigend. Wenn es wirklich so wäre, müßte man vor diesem Gesang, zunächst und immer das Gefühl des Außerordentlichen haben, das Gefühl aus dieser Kehle erklinge etwas, was wir nie vorher gehört haben und das zu hören wir auch eigentlich gar nicht die Fähigkeit haben, etwas was zu hören uns nur diese eine Josefine und niemand sonst befähigt. Gerade das trifft aber meiner Meinung nach nicht zu, ich wenigstens fühle es nicht und habe auch bei andern derartige Beobachtungen nicht machen können. Im vertrauten Kreise gestehen wir einander offen, daß Josefinens Gesang als Gesang eigentlich nichts außerordentliches darstellt. Ist es denn überhaupt Gesang? Trotz unserer Unmusikalität haben wir Gesangsüberlieferungen, in den alten Zeiten unseres Volkes gab es Gesang, Sagen erzählen davon und sogar Lieder sind erhalten, die freilich niemand mehr singen kann; ich weiß nicht, warum wir im Laufe der Jahrhunderte so gründlich uns abwandten von aller Musik, vielleicht wurde durch unsere besonderen Schicksale die Stille, die Zurückhaltung uns unwiderstehlich auferlegt – wie dies alles auch sein mag, eine Ahnung dessen was Gesang ist haben wir und dieser Ahnung nun entspricht Josefinens Kunst eigentlich nicht. Ist es denn überhaupt Gesang, ist es nicht vielleicht doch nur ein Pfeifen? Und Pfeifen allerdings kennen wir alle, es ist die eigentliche Kunst unseres Volkes oder vielmehr gar keine Kunst, sondern eine charakteristische Lebensäußerung, ein leises etwas zischendes Pfeifen, von dem es kaum mehr als zwei Abarten gibt, das wehmütige, verzichtende, träumerische, besonders schwache aber eindringende und dann das gewissermaßen triumphierende, langhintönende, schärfere. So pfeifen wir alle, aber niemand denkt daran das als Kunst auszugeben, hie und da stellt jemand darüber zu besondern Zwecken Beobachtungen an, aber im allgemeinen pfeifen wir, ohne daran zu denken, ja ohne es zu merken und es gibt gewiß sogar viele unter uns, die gar nicht wissen daß das Pfeifen zu unseren Eigentümlichkeiten gehört. Wenn es also wahr wäre, daß Josefine nicht singt, sondern nur pfeift und vielleicht gar, wie es mir wenigstens scheint, über die Grenzen des üblichen Pfeifens kaum hinauskommt, ja vielleicht reicht ihre Kraft für jenes triumphierende Pfeifen nicht einmal ganz hin, während es ein gewöhnlicher Erdarbeiter ohne Mühe den ganzen Tag über neben seiner Arbeit zustandebringt – wenn das alles wahr wäre, dann wäre zwar Josefinens angebliche Künstlerschaft widerlegt, aber es wäre dann erst recht das Rätsel ihrer großen Wirkung zu lösen. Es ist eben doch nicht nur Pfeifen, das sie produciert, stellt man sich recht weit von ihr hin und horcht, oder noch besser, läßt man sich in dieser Hinsicht prüfen, singt also Josefine etwa unter andern Stimmen und setzt man sich die Aufgabe ihre Stimme zu erkennen, dann wird man unweigerlich nichts anderes hören als ein gewöhnliches mittelmäßiges höchstens durch Zartheit oder Schwäche ein wenig auffallendes Pfeifen. Aber steht man vor ihr, ist es doch nicht nur ein Pfeifen, es ist zum Verständnis ihrer Kunst notwendig, sie nicht nur zu hören sondern auch zu sehn. Selbst wenn es nur unser tagtägliches Pfeifen wäre, so besteht hier doch schon zunächst die Sonderbarkeit, daß jemand sich feierlich hinstellt, um nichts anderes als das Übliche zu tun. Eine Nuß aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst, deshalb wird auch niemand wagen, ein Publikum zusammenzurufen und vor ihm, um es zu unterhalten, Nüsse knacken. Tut er es dennoch und gelingt seine Absicht, dann kann es sich eben doch nicht nur um bloßes Nüsseknacken handeln. Oder es handelt sich um Nüsseknacken, aber es stellt sich heraus, daß wir über diese Kunst hinweggesehn haben, weil wir sie glatt beherrschten und daß uns dieser neue Nußknacker erst ihr eigentliches Wesen zeigt, wobei es dann für die Wirkung nützlich sein könnte, wenn er sogar etwas weniger tüchtig im Nüsseknacken ist als die Mehrzahl von uns. Vielleicht verhält es sich ähnlich mit Josefinens Gesang, wir bewundern an ihr das, was wir an uns gar nicht bewundern, übrigens sind wir darin in völliger Übereinstimmung mit ihr. Ich war einmal zugegen, als sie jemand, wie dies natürlich öfters geschieht, auf das allgemeine Volkspfeifen aufmerksam machte undzwar ganz bescheiden, so wie man etwa einem Reichen durch den Hinweis darauf, daß man selbst noch nicht verhungert ist, gewiß nicht wehtun, sondern eher zum ungestörten Genuß seiner Reichtümer verhelfen will. Aber für Josefine war es zu viel, ein so freches, hochmütiges Lächeln, wie sie es damals aufsetzte, habe ich noch nicht gesehn; sie, die äußerlich eigentlich vollendete Zartheit ist, auffallend zart selbst in unserem an solchen Frauengestalten reichen Volk, erschien damals geradezu gemein, sie mochte es übrigens in der großen Empfindlichkeit der Künstlerin auch gleich selbst fühlen und faßte sich. Jedenfalls leugnet sie also jeden Zusammenhang zwischen ihrer Kunst und dem Pfeifen, für die welche gegenteiliger Meinung sind hat sie nur Verachtung und wahrscheinlich uneingestandenen Haß. Das ist nicht Eigennutz, denn diese Opposition, zu der auch ich halb gehöre, bewundert sie gewiß nicht weniger als es die Menge tut, aber Josefine will nicht nur bewundert, sondern genau in der von ihr bestimmten Art bewundert sein, an Bewunderung allein liegt ihr nichts. Und wenn man vor ihr sitzt, versteht man sie, Opposition treibt man nur in der Ferne; wenn man vor ihr sitzt, weiß man: was sie hier pfeift, ist kein Pfeifen. Da Pfeifen zu unsern gedankenlosen Gewohnheiten gehört, könnte man meinen daß auch in Josefinens Auditorium gepfiffen wird, es wird uns wohl bei ihrer Kunst und wenn uns wohl ist, pfeifen wir, aber ihr Auditorium pfeift nicht, es ist mäuschenstill, so als wären wir des ersehnten Friedens, von dem uns zumindest unser eigenes Pfeifen abhält, teilhaftig geworden, schweigen wir. Ist es ihr Gesang, der uns entzückt oder nicht vielmehr die Feierlichkeit der Stille, von der das schwache Stimmchen umgeben ist? Einmal geschah es, daß irgendein törichtes kleines Ding während Josefinens Gesang in aller Unschuld auch zu pfeifen anfieng. Nun, es war ganz dasselbe was wir auch von Josefine hörten, dort vorne das trotz aller Routine immer noch schüchterne Pfeifen und hier im Publikum das selbstvergessene kindliche Gepfeife; den Unterschied zu bezeichnen wäre unmöglich gewesen, aber doch zischten und pfiffen wir gleich die Störerin nieder, trotzdem es gar nicht nötig gewesen wäre, denn sie hätte sich gewiß auch sonst in Angst und Scham verkrochen, während Josefine ihr Triumphpfeifen anstimmte und vor Selbstzufriedenheit ganz außer sich war mit ihren ausgespreizten Armen und dem gar nicht mehr höher dehnbaren Hals. So ist sie übrigens immer, jede Kleinigkeit, jeden Zufall, jede winzige Widerspenstigkeit, ein Knacken im Parkett, ein Zähneknirschen, eine Beleuchtungsstörung hält sie für geeignet die Wirkung ihres Gesanges zu erhöhen, sie singt ja ihrer Meinung nach vor stumpfen Ohren, an Begeisterung und Beifall fehlt es nicht, aber auf wirkliches Verständnis, wie sie es meint, hat sie längst verzichten gelernt, da kommen ihr dann alle Störungen sehr gelegen, alles was sich der Reinheit ihres Gesanges entgegenstellt, in leichtem Kampf, ja ohne Kampf, bloß durch die Gegenüberstellung besiegt wird, kann dazu beitragen die Menge zu erwecken, sie zwar nicht Verständnis, aber ahnungsvollen Respekt zu lehren. Und es wäre recht gut denkbar, daß sie, wenn es nicht ihrer zerstreuten träumerischen das Zweckmäßige mißachtenden Künstlerart widersprechen würde, selbst z. B. damals jenes arme unschuldige Ding zum Pfeifen veranlaßt hätte. Wenn ihr aber nun das Kleine so dient wie erst das Große. Unser Leben ist sehr unruhig, jeder Tag bringt Überraschungen, Beängstigungen, Hoffnungen und Schrecken, daß der einzelne unmöglich dies alles ertragen könnte, hätte er nicht jederzeit bei Tag und Nacht den Rückhalt der Genossen, aber selbst so wird es oft recht schwer, manchmal zittern selbst tausend Schultern unter der Last, die eigentlich nur für einen bestimmt war. Dann hält Josefine ihre Zeit für gekommen. Schon steht sie da, das zarte Wesen, besonders unterhalb der Brust beängstigend vibrierend, es ist als hätte sie alle ihre Kraft im Gesang versammelt, als sei allem an ihr was nicht dem Gesange unmittelbar diene, jede Kraft, fast jede Lebensmöglichkeit entzogen, als sei sie völlig entblößt, preisgegeben, nur dem Schutz guter Geister überantwortet, als könne sie, während sie so, sich völlig entzogen, im Gesange wohne, ein kalter Hauch im Vorüberwehn töten. Aber gerade bei solchem Anblick pflegen wir angeblichen Gegner uns zu sagen: Sie kann nicht einmal pfeifen, so entsetzlich muß sie sich anstrengen, um nicht Gesang – reden wir nicht von Gesang – aber um das landesübliche Pfeifen einigermaßen sich abzuzwingen. So scheint es uns, doch ist dies, wie schon erwähnt, ein zwar unvermeidlicher, aber flüchtiger, schnell vorübergehender Eindruck. Schon tauchen auch wir in das Gefühl der Menge, die warm, Leib an Leib, scheu und atmend horcht. Und um diese Menge unseres fast immer in Bewegung befindlichen, wegen oft nicht sehr klarer Zwecke hin- und herschießenden Volkes um sich zu versammeln, muß Josefine meist nichts anderes tun, als mit zurückgeworfenem Köpfchen, halboffenem Munde, aufgerissenen der Höhe zugewandten Augen jene Stellung einnehmen, die darauf hindeutet, daß sie zu singen beabsichtigt. Sie kann dies tun, wo sie will, es muß kein weithin sichtbarer Platz sein, irgendein verborgener, in zufälliger Augenblickslaune gewählter Winkel ist ebensogut brauchbar. Die Nachricht, daß sie singen will, verbreitet sich gleich und bald zieht es in Processionen hin. Nun, manchmal treten doch Hindernisse ein, Josefine singt mit Vorliebe gerade in aufgeregten Zeiten, vielfache Sorgen und Nöte zwingen uns dann zu vielerlei Wegen, man kann sich beim besten Willen nicht so schnell versammeln, wie es Josefine wünscht, und sie steht dort wohl in ihrer großen Haltung eine Zeitlang ohne genügende Hörerzahl, dann freilich wird sie wütend, dann stampft sie mit den Füßen, flucht ganz unmädchenhaft, ja sie beißt sogar. Aber selbst ein solches Verhalten schadet ihrem Rufe nicht, statt ihre übergroßen Ansprüche ein wenig einzudämmen, strengt man sich an, ihnen zu entsprechen, es werden Boten ausgeschickt, um Hörer herbeizuholen, es wird vor ihr geheimgehalten, daß das geschieht, man sieht dann auf den Wegen im Umkreis Posten aufgestellt, die den Herankommenden zuwinken, sie möchten sich beeilen – dies alles solange bis dann schließlich doch eine leidliche Anzahl beisammen ist. Was treibt das Volk dazu, sich für Josefine so zu bemühn? Eine Frage nicht leichter zu beantworten, als die nach Josefinens Gesang mit der sie ja auch zusammenhängt. Man könnte sie streichen und gänzlich mit der zweiten Frage vereinigen, wenn sich etwa behaupten ließe, daß das Volk wegen des Gesanges oder aus sonstigen Gründen Josefine bedingungslos ergeben ist. Dies ist aber eben nicht der Fall, bedingungslose Ergebenheit kennt unser Volk kaum, dieses Volk, das über alles die freilich harmlose Schlauheit liebt, das kindliche Wispern, den freilich unschuldigen bloß die Lippen bewegenden Tratsch, ein solches Volk kann immerhin nicht bedingungslos sich hingeben, das fühlt wohl auch Josefine, das ist es, was sie bekämpft mit aller Anstrengung ihrer schwachen Kehle. Nun darf man freilich bei solchen allgemeinen Urteilen nicht zu weit gehn, das Volk ist Josefine doch ergeben, nur eben nicht bedingungslos. Es wäre z. B. nicht fähig über Josefine zu lachen. Man darf es sich eingestehn: an Josefine fordert vieles zum Lachen auf, und an und für sich ist uns das Lachen immer nah, trotz allem Jammer unseres Lebens ist ein leises Lachen bei uns gewissermaßen immer zuhause, aber über Josefine lachen wir nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, das Volk fasse sein Verhältnis zu Josefine derart auf, daß sie, dieses zerbrechliche, schonungsbedürftige, irgendwie ausgezeichnete, ihrer Meinung nach durch Gesang ausgezeichnete Wesen ihm anvertraut sei und es müsse für sie sorgen, der Grund dessen ist wahrscheinlich niemandem klar, aber die Tatsache scheint festzustehn. Über das was einem anvertraut ist lacht man nicht, man kann über sich selbst lachen, aber nicht über das einem Anvertraute, darüber zu lachen wäre Pflichtverletzung, es ist das Äußerste an Boshaftigkeit was die Boshaftesten unter uns Josefine zufügen wenn sie manchmal sagen: Das Lachen vergeht uns, wenn wir Josefine sehn. So sorgt also das Volk für Josefine in der Art eines Vaters, der sich seines Kindes annimmt, das sein Händchen man weiß nicht recht ob bittend oder fordernd nach ihm ausstreckt. Man sollte meinen, unser Volk tauge nicht zur Erfüllung solcher väterlicher Pflichten, aber in Wirklichkeit versieht es sie wenigstens in diesem Falle musterhaft, ich könnte es gewiß nicht und kein einzelner könnte es, was in dieser Hinsicht das Volk als Ganzes zu tun imstande ist. Freilich, der Kraftunterschied zwischen dem Volk und seinem Schützling ist so ungeheuer, es genügt daß es den Schützling in die Wärme seiner Nähe zieht und er ist beschützt genug. Zu Josefine wage man allerdings von solchen Dingen nicht zu reden. "Ich pfeife auf Eueren Schutz", sagt sie dann. "Ja, ja, Du pfeifst", denken wir. Und außerdem ist es wahrhaftig keine Widerlegung, wenn sie so rebelliert, vielmehr ist das durchaus Kindesart und Kindesdankbarkeit und Art des Vaters ist es, sich nicht daran zu kehren. Nun spielt aber eben doch noch anderes herein, das schwerer aus diesem Verhältnis zwischen Volk und Josefine, wie ich es deute, zu erklären ist. Josefine ist nämlich der gegenteiligen Meinung, sie glaubt, sie sei es, die das Volk beschütze. Aus schlimmer politischer oder wirtschaftlicher Lage rettet uns angeblich ihr Gesang, nichts weniger als das bringt er zuwege und wenn er das Unglück nicht vertreibt, so gibt er uns wenigstens die Kraft es zu ertragen. Sie spricht es nicht so aus und auch nicht anders, sie spricht überhaupt wenig, sie ist schweigsam unter den Plappermäulern, aber aus ihren Augen blitzt es, von ihrem geschlossenen Mund – bei uns können nur wenige den Mund geschlossen halten, sie kann es – ist es abzulesen. Bei jeder schlechten Nachricht – und an manchen Tagen überrennen sie einander, falsche und halbrichtige darunter – erhebt sie sich sofort, während es sie sonst immer müde zum Boden zieht, erhebt sich und streckt den Hals und sucht den Überblick über ihre Herde wie der Hirt vor dem Gewitter. Gewiß, auch Kinder stellen ähnliche Forderungen in ihrer wilden unbeherrschten Art, aber bei Josefine sind sie doch nicht so unbegründet wie bei jenen. Freilich sie rettet uns nicht und gibt uns nicht die entscheidenden Kräfte, es ist leicht sich als Retter dieses Volkes aufzuspielen, das leidensgewohnt, den Tod wohl kennend, sich nicht schonend, schnell in Entschlüssen, nur dem Anschein nach ängstlich in der Atmosphäre von Tollkühnheit in der es ständig lebt und überdies ebenso fruchtbar wie wagemutig, es ist leicht, sage ich, sich nachträglich als Retter dieses Volkes aufzuspielen, das sich noch immer irgendwie selbst gerettet hat, sei es auch unter Opfern, über die der Geschichtsforscher – im allgemeinen vernachlässigen wir Geschichtsforschung gänzlich – vor Schrecken erstarrt. Und doch ist es wahr, daß wir gerade in Notlagen noch besser als sonst auf Josefinens Stimme horchen. Die Drohungen, die über uns stehen, machen uns stiller, bescheidener, für Josefinens Befehlshaberei gefügiger, gern kommen wir zusammen, gern drängen wir uns aneinander, besonders weil es bei einem Anlaß geschieht, der ganz abseits liegt von der quälenden Hauptsache, es ist als tränken wir noch schnell – ja, Eile ist nötig, das vergißt Josefine allzuoft – gemeinsam einen Becher des Friedens vor dem Kampf. Es ist nicht so sehr eine Gesangsvorführung, als vielmehr eine Volksversammlung undzwar eine Versammlung, bei der es bis auf das kleine Pfeifen vorne, völlig still ist, viel zu ernst ist die Stunde, als daß man sie verschwätzen wollte. Ein solches Verhältnis könnte nun freilich Josefine gar nicht befriedigen und es wäre auch für die Dauer nicht haltbar. Trotz allen ihres nervösen Mißbehagens, welches Josefine wegen ihrer niemals ganz geklärten Stellung erfüllt, sieht sie doch, verblendet von ihrem Selbstbewußtsein, manches nicht und kann ohne große Anstrengung dazu gebracht werden noch viel mehr zu übersehn, ein Schwarm von Schmeichlern ist in diesem Sinne, also eigentlich in einem allgemein nützlichen Sinne immerfort tätig, aber nur nebenbei, unbeachtet, im Winkel einer Volksversammlung zu singen, dafür würde sie, trotzdem es an sich gar nicht wenig wäre, ihren Gesang gewiß nicht opfern. Und das muß sie auch nicht, denn ihre Kunst bleibt nicht unbeachtet. Trotzdem wir mit ganz andern Dingen beschäftigt sind und die Stille durchaus nicht nur dem Gesange zuliebe herrscht und mancher gar nicht aufschaut, sondern das Gesicht in den Pelz des Nachbars drückt und Josefine also dort oben sich vergeblich abzumühen scheint, dringt doch – das ist nicht zu leugnen – etwas von ihrem Pfeifen unweigerlich auch zu uns. Dieses Pfeifen, das sich erhebt, wo allen andern Schweigen auferlegt ist, kommt fast wie eine Botschaft des Volkes zu dem Einzelnen, das dünne Pfeifen Josefinens mitten in den schweren Entscheidungen ist fast wie die armselige Existenz unseres Volkes mitten im Tumult der feindlichen Welt. Josefine behauptet sich, dieses Nichts an Stimme, dieses Nichts an Leistung behauptet sich und schafft sich den Weg zu uns, es tut wohl daran zu denken; einen wirklichen Gesangskünstler, wenn einer einmal sich unter uns finden sollte, würden wir in solcher Zeit gewiß nicht ertragen und die Unsinnigkeit einer solchen Vorführung einmütig abweisen. Möge Josefine beschützt werden vor der Erkenntnis, daß die Tatsache, daß wir ihr zuhören, ein Beweis gegen ihren Gesang ist. Eine Ahnung dessen hat sie wohl, warum würde sie sonst so leidenschaftlich leugnen, daß wir ihr zuhören, aber immer wieder singt sie, pfeift sie sich über diese Ahnung hinweg. Aber es gäbe auch sonst noch immer einen Trost für sie: wir hören ihr doch auch gewissermaßen wirklich zu, wahrscheinlich ähnlich wie man einem Gesangskünstler zuhört, sie erreicht Wirkungen, die ein Gesangskünstler vergeblich bei uns anstreben würde und die nur gerade ihren unzureichenden Mitteln verliehen sind. Es hängt wohl auch mit unserer Lebensweise zusammen. In unserem Volk kennt man keine Jugend, kaum eine winzige Kinderzeit. Von Zeit zu Zeit treten zwar Forderungen auf, man möge den Kindern eine besondere Freiheit, eine besondere Schonung gewährleisten, ihr Recht auf ein wenig Sorglosigkeit, ein wenig sinnloses Sich-Herumtummeln, auf ein wenig Spiel, dieses Recht möge man anerkennen und ihm zur Erfüllung verhelfen, solche Forderungen treten auf und fast jedermann billigt sie, es gibt nichts was mehr zu billigen wäre, aber es gibt auch nichts, was in der Wirklichkeit unseres Lebens weniger zugestanden werden könnte, man billigt die Forderungen, man macht Versuche in ihrem Sinn, aber bald ist wieder alles beim Alten. Unser Leben ist eben derart, daß ein Kind, sobald es nur ein wenig läuft und die Umwelt ein wenig unterscheiden lernt, ebenso für sich sorgen muß, wie ein Erwachsener, die Gebiete, auf denen wir aus wirtschaftlichen Rücksichten zerstreut leben müssen, sind zu groß, unserer Feinde sind zu viele, die für uns überall bereiteten Gefahren zu unberechenbar – wir können die Kinder vom Existenzkampf nicht fernhalten, täten wir es, es wäre ihr vorzeitiges Ende. Zu diesen traurigen Gründen kommt freilich auch ein erhebender: die Fruchtbarkeit unseres Stammes. Eine Generation – und jede ist zahlreich – drängt die andere, die Kinder haben nicht Zeit, Kinder zu sein. Mögen bei andern Völkern die Kinder sorgfältig gepflegt werden, mögen dort Schulen für die Kleinen errichtet sein, mögen dort aus diesen Schulen täglich die Kinder strömen, die Zukunft des Volkes, der schönste Anblick dem Patrioten, so sind es doch immer lange Zeit die gleichen Kinder, die dort hervorkommen. Wir haben keine Schulen, aber aus unserem Volke strömen in allerkürzesten Zwischenräumen die unübersehbaren Scharen unserer Kinder, fröhlich zischend oder piepsend solange sie noch nicht pfeifen können, sich wälzend oder kraft des Druckes weiterrollend solange sie noch nicht laufen können, täppisch durch ihre Masse alles mit sich fortreißend, solange sie noch nicht sehen können, unsere Kinder! Und nicht wie in jenen Schulen die gleichen Kinder, nein, immer, immer wieder neue, ohne Ende, ohne Unterbrechung, kaum erscheint ein Kind, ist es nicht mehr Kind, aber schon drängen hinter ihm die neuen Kindergesichter, ununterscheidbar in ihrer Menge und Eile, rosig vor Glück. Freilich, wie schön dies auch sein mag und wie sehr uns andere darum auch mit Recht beneiden mögen, eine wirkliche Kinderzeit können wir eben unsern Kindern nicht geben. Und das hat seine Folgewirkungen. Eine gewisse unerstorbene unausrottbare Kindlichkeit durchdringt unser Volk; im geraden Widerspruch zu unserem Besten, dem untrüglichen praktischen Verstand, handeln wir manchmal ganz und gar töricht undzwar eben in der Art wie Kinder töricht handeln, sinnlos verschwenderisch, großzügig, leichtsinnig und dies alles oft einem kleinen Spaß zuliebe. Und wenn unsere Freude darüber natürlich nicht mehr die volle Kraft der Kinderfreude haben kann, etwas von dieser lebt darin noch gewiß. Ist es vielleicht diese Kindlichkeit unseres Volkes, von der auch Josefine profitiert? Aber unser Volk ist nicht nur kindlich, es ist gewissermaßen auch vorzeitig alt, Kindheit und Alter mischen sich bei uns anders als bei andern. Wir haben keine Jugend, wir sind gleich Erwachsene, und Erwachsene sind wir dann zu lange, eine gewisse Müdigkeit und Hoffnungslosigkeit durchzieht von da aus mit breiter Spur das im Ganzen doch so zähe und hoffnungsstarke Wesen unseres Volkes. Damit hängt wohl auch unsere Unmusikalität zusammen, wir sind zu alt für Musik, ihre Erregung, ihr Aufschwung paßt nicht für unsere Schwere, müde winken wir ihr ab, wir haben uns auf das Pfeifen zurückgezogen, ein wenig Pfeifen hie und da, das ist das Richtige für uns. Wer weiß ob es nicht Musiktalente unter uns gibt, wenn es sie aber auch gäbe, der Charakter des Volksganzen müßte sie noch vor ihrer Entfaltung unterdrücken. Dagegen mag Josefine nach ihrem Belieben pfeifen oder singen oder wie sie es nennen will, das stört uns nicht, das entspricht uns, das können wir wohl vertragen, wenn darin etwas von Musik enthalten sein sollte, so ist es auf die möglichste Nichtigkeit reduciert, eine gewisse Musiktradition wird gewahrt, aber ohne daß uns dies im geringsten beschweren würde. Aber Josefine bringt diesem derart gestimmten Volk noch mehr. Bei ihren Koncerten besonders in ernster Zeit haben nur wenige Interesse an der Sängerin als solcher, vielleicht sieht mancher in den ersten Reihen neugierig zu, wie sie ihre Lippen kräuselt, zwischen den niedlichen Vorderzähnen die Luft ausstößt, in Bewunderung der Töne die sie selbst hervorbringt erstirbt und dieses Hinsinken benützt um sich zu neuer ihr immer unverständlicher werdender Leistung anzufeuern, aber die eigentliche Menge hat sich – das ist deutlich zu erkennen – auf sich selbst zurückgezogen. Hier in den dürftigen Pausen zwischen den Kämpfen träumt das Volk, es ist als lösten sich dem Einzelnen die Glieder, als dürfte sich der Ruhelose einmal nach seiner Lust im großen warmen Bett des Volkes dehnen und strecken. Und in diese Träume klingt hie und da Josefinens Pfeifen, sie nennt es perlend, wir nennen es stockend, aber jedenfalls ist es hier an seinem Platz wie nirgends sonst, wie Musik kaum jemals den auf sie wartenden Augenblick findet. Etwas von der armen kurzen Kindheit ist darin, etwas von verlorenem, nie wieder aufzufindendem Glück, aber auch etwas vom tätigen heutigen Leben ist darin, von seiner kleinen unbegreiflichen und dennoch bestehenden und nicht zu ertötenden Munterkeit, Und dies alles ist wahrhaftig nicht mit großen Tönen gesagt, sondern leicht, flüsternd, vertraulich, manchmal ein wenig heiser. Natürlich ist es ein Pfeifen; wie denn nicht? Pfeifen ist die Sprache unseres Volkes, nur pfeift mancher sein Leben lang und weiß es nicht, hier aber ist das Pfeifen freigemacht von den Fesseln des täglichen Lebens und befreit auch uns für eine kurze Weile. Deshalb wollten wir diese Vorführungen nicht missen. Sollte also vielleicht auf diese Weise Josefine doch Recht haben wenn sie behauptet daß sie uns in solchen Zeiten neue Kräfte gibt. Wie könnte man auch anders – sagen Josefinens Schmeichler in recht unbefangener Keckheit – den großen Zulauf besonders unter unmittelbar drängender Gefahr erklären, der schon manchmal sogar die genügende, rechtzeitige Abwehr eben dieser Gefahr verhindert hat. Nun, dies letztere ist richtig, gehört aber doch gewiß nicht zu den Ruhmestiteln Josefinens, besonders wenn man hinzufügt, daß, wenn solche Versammlungen unerwartet vom Feind gesprengt wurden und mancher der unsrigen dabei sein Leben lassen mußte, Josefine, die alles verschuldet, ja durch ihr Pfeifen den Feind vielleicht angelockt hatte, immer das sicherste Plätzchen hatte und unter dem Schutz ihres Anhangs sehr still und eiligst als erste verschwand. Aber auch dieses wissen im Grunde alle und dennoch eilen sie wieder hin, wenn Josefine nächstens nach ihrem Belieben, irgendwo, irgendwann zum Gesange sich erhebt. Daraus – denn dies ist doch schon etwas Äußerstes – könnte man schließen, daß Josefine fast außerhalb des Gesetzes steht, daß sie tun darf, was sie will und daß ihr alles verziehen wird. Wenn dies so wäre, wären dann auch Josefinens Ansprüche völlig verständlich, ja man könnte gewissermaßen in dieser Freiheit die ihr das Volk geben würde, in diesem außerordentlichen, niemand sonst gewährten, die Gesetze eigentlich widerlegenden Geschenk ein Eingeständnis dessen sehn, daß das Volk Josefine, wie sie es behauptet, nicht versteht, ohnmächtig ihre Kunst anstaunt, sich ihrer nicht würdig fühlt, dieses Leid, das es Josefine tut, durch eine geradezu verzweifelte Leistung auszugleichen strebt und so wie ihre Kunst außerhalb seines Begriffsvermögens ist, auch ihre Person und deren Wünsche außerhalb seiner Befehlsgewalt stellt. Nun, das ist allerdings ganz und gar nicht richtig, vielleicht kapituliert im Einzelnen unser Volk zu schnell vor Josefine, aber wie es bedingungslos vor niemandem kapituliert, also auch nicht vor ihr. Das ist leicht zu beweisen. Schon seit langer Zeit, vielleicht schon seit Beginn ihrer Künstlerlaufbahn kämpft Josefine darum, daß sie mit Rücksicht auf ihren Gesang von jeder Arbeit befreit werde, man solle ihr also die Sorge um das tägliche Brot und 'alles was sonst mit unserem Existenzkampf verbunden ist abnehmen und es – wahrscheinlich – auf das Volk als Ganzes überwälzen. Ein schnell Begeisterter – es fanden sich wenn ich nicht irre auch solche – könnte schon allein aus der Sonderbarkeit dieser Forderung, aus der Geistesverfassung, die eine solche Forderung auszudenken imstande ist, auf deren innere Berechtigung schließen. Unser Volk zieht aber andere Schlüsse und lehnt ruhig die Forderung ab. Es müht sich auch mit der Widerlegung der Gesuchsbegründung nicht sehr ab. Josefine weist z. B. darauf hin, daß die Anstrengung bei der Arbeit ihrer Stimme schade, daß zwar die Anstrengung bei der Arbeit gering sei im Vergleich zu jener beim Gesang, daß sie ihr aber doch die Möglichkeit nehme, nach dem Gesang sich genügend auszuruhn und für neuen Gesang sich zu stärken, sie müsse sich dabei gänzlich erschöpfen und könne trotzdem unter diesen Umständen ihre Höchstleistung niemals erreichen. Das Volk hört dies an und geht darüber hinweg. Dieses so leicht zu rührende Volk ist manchmal gar nicht zu rühren. Die Abweisung ist manchmal so hart, daß selbst Josefine stutzt, sie scheint sich zu fügen, arbeitet wie sichs gehört, singt so gut sie kann, aber nur eine Weile, dann nimmt sie den Kampf mit neuen Kräften – dafür scheint sie unbeschränkt viele zu haben – wieder auf. Nun ist es ja klar, daß Josefine nicht eigentlich da's anstrebt was sie wörtlich verlangt. Sie ist vernünftig, sie scheut die Arbeit nicht, wie ja Arbeitsscheu überhaupt bei uns unbekannt ist, sie würde, wenn ihrer Forderung nachgegeben würde, gewiß nicht anders leben als früher, die Arbeit würde ihrem Gesang gar nicht im Wege stehn und allerdings der Gesang auch nicht schöner werden – was sie anstrebt ist also nur die öffentliche, eindeutige, die Zeiten überdauernde, über alles Übliche sich weit erhebende Anerkennung ihrer Kunst. Während ihr aber fast alles andere erreichbar scheint, versagt sich ihr dieses hartnäckig. Vielleicht hätte sie den Angriff gleich anfangs in anderer Richtung lenken sollen, vielleicht sieht sie jetzt selbst den Fehler ein, aber nun kann sie nicht mehr zurück, ein Zurückgehn hieße sich selbst untreu werden, nun muß sie schon mit dieser Forderung stehn oder fallen. Hätte sie wirklich Feinde, wie sie sagt, sie könnten diesem Kampfe, ohne selbst den Finger rühren zu müssen, belustigt zusehn. Aber sie hat keine Feinde und selbst wenn mancher hie und da Einwände gegen sie hatte, dieser Kampf belustigt gewiß niemanden. Schon deshalb nicht, weil sich hier das Volk in einer kalten unerschütterlichen richterlichen Haltung zeigt, wie man es sonst bei uns nur sehr selten sieht. Und wenn einer auch diese Haltung in diesem Fall billigen mag, so schließt doch der Gedanke, daß sich einmal das Volk ähnlich gegen ihn selbst verhalten könnte, jede Freude aus. Es handelt sich eben, wie bei der Forderung, so auch bei der Abweisung nicht eigentlich um die Sache selbst, sondern mehr darum, daß sich das Volk gegen einen Volksgenossen derart undurchdringlich abschließen kann und um so. undurchdringlicher, als es sonst um eben diesen Genossen väterlich und mehr als väterlich, demütig sorgt. Stünde hier an Stelle des Volkes ein Einzelner könnte man fast glauben, dieser Mann habe die ganze Zeit über Josefine nachgegeben unter dem fortwährenden Verlangen endlich der Nachgiebigkeit ein Ende zu machen, er habe übermenschlich viel nachgegeben in der festen Überzeugung daß das Nachgeben trotzdem seine Grenze finden werde, ja er habe mehr nachgegeben, als nötig war, um die Sache zu beschleunigen, um Josefine zu verwöhnen und zu immer neuen Wünschen zu treiben, bis dann Josefine wirklich diese letzte Forderung erhob, da habe er nun freilich, kurz, weil schon längst vorbereitet, die endgiltige Abweisung vorgenommen. Nun, so verhält es sich ganz gewiß nicht, das Volk braucht solche Listen nicht, außerdem ist seine Verehrung für Josefine aufrichtig und erprobt und Josefinens Forderung ist allerdings so stark, daß jedes unbefangene Kind ihr den Ausgang hätte voraussagen können, trotzdem mag es sein daß in der Auffassung die Josefine von der Sache hat, auch solche Vermutungen ein wenig mitspielen und dem Schmerz der Abgewiesenen eine Bitternis hinzufügen. Aber mag sie auch solche Vermutungen haben, vom Kampfe abschrecken läßt sie sich dadurch nicht. In letzter Zeit verschärft sich sogar der Kampf, hat sie ihn bisher nur durch Worte geführt, fängt sie jetzt an andere Mittel anzuwenden, die ihrer Meinung nach wirksamer, unserer Meinung nach lediglich für sie selbst gefährlicher sind. Manche glauben, Josefine werde deshalb so dringlich, weil sie sich alt werden fühle, die Stimme Schwächen zeige und es ihr daher höchste Zeit zu sein scheint, den letzten Kampf um ihre Anerkennung zu führen. Ich glaube daran nicht. Josefine wäre nicht Josefine wenn dies wahr wäre. Für sie gibt es kein Altern, und keine Schwächen ihrer Stimme. Wenn sie etwas fordert, so wird sie nicht durch äußere Dinge, sondern durch innere Folgerichtigkeit dazu gebracht. Sie greift nach dem höchsten Kranz, nicht weil er im Augenblick gerade ein wenig tiefer hängt, sondern weil es der höchste Kranz ist; wäre es in ihrer Macht, sie würde ihn noch höher hängen. Diese Geistesverfassung hindert sie allerdings nicht, die unwürdigsten Mittel anzuwenden. Ihr Recht steht ihr außer Zweifel, was liegt also daran wie sie es erreicht, besonders da doch, wie sie die Welt beurteilt, die würdigen Mittel versagen müssen. Vielleicht hat sie sogar deshalb den Kampf um ihr Recht aus dem Gebiet des Gesanges auf ein anderes, ihr weniger teueres verlegt. Ihr Anhang hat Aussprüche von ihr in Umlauf gebracht, nach denen sie sich durchaus fähig fühlt, so zu singen daß es dem Volk in allen seinen Schichten bis in die versteckteste Opposition hinein eine wirkliche Lust wäre, wirkliche Lust nicht im Sinne des Volkes, welches ja behauptet diese Lust seit jeher bei Josefinens Gesang zu fühlen, sondern Lust im Sinne von Josefinens Verlangen. Aber, fügt sie hinzu, da sie das Hohe nicht fälschen und dem Gemeinen nicht schmeicheln könne, müsse es eben bleiben, wie es sei. Anders aber ist es bei ihrem Kampf um die Arbeitsbefreiung, zwar ist es auch ein Kampf um ihren Gesang, aber hier kämpft sie nicht unmittelbar mit der kostbaren Waffe des Gesanges und kann daher, so denkt sie wahrscheinlich, auch die häßlichsten Mittel verwenden.
So wurde z. B. das Gerücht verbreitet, Josefine beabsichtige, wenn man ihr nicht nachgebe, die Koloraturen zu kürzen. Ich weiß nichts von Koloraturen, habe in ihrem Gesange niemals etwas von Koloraturen bemerkt, die unserer allgemein etwas rauhen wilden ungepflegten und in dieser Hinsicht gar nicht zu pflegenden Stimme wahrscheinlich von Natur aus für immer versagt sind, Josefine will aber die Koloraturen kürzen, vorläufig nicht beseitigen sondern nur kürzen. Sie hat angeblich ihre Drohung wahrgemacht, mir allerdings ist kein Unterschied gegenüber ihren früheren Vorführungen aufgefallen. Das Volk als Ganzes hat zugehört wie immer, ohne sich über die Koloraturen zu äußern, und auch die Behandlung von Josefinens Forderung hat sich nicht geändert. Wie in ihrer Gestalt hat Josefine unleugbar auch in ihrem Denken manchmal etwas Graziöses. So hat sie z. B. nach jener Vorführung, so als sei ihr Entschluß hinsichtlich der Koloraturen gegenüber dem Volke doch zu hart gewesen, erklärt, nächstens werde sie die Koloraturen doch wieder vollständig singen. Aber nach dem nächsten Koncert besann sie sich wieder anders, nun sei es endgültig zuende mit den großen Koloraturen und vor einer für Josefine günstigen Entscheidung werde man sie nicht mehr hören. Nun, das Volk hört über alle diese Erklärungen, Entschlüsse und Entschlußänderungen hinweg, wie ein Erwachsener in Gedanken über das Plaudern eines Kindes hinweghört, grundsätzlich wohlwollend aber unerreichbar.
Josefine aber gibt nicht nach. So behauptete sie, sie habe sich bei der Arbeit eine Fußverletzung zugezogen, die ihr das Stehn während des Gesanges sehr beschwerlich macht, da sie aber nur stehend singen könne müsse sie jetzt sogar die Gesänge kürzen. Trotzdem sie hinkt und sich von ihrem Anhang stützen läßt glaubt doch niemand an eine wirkliche Verletzung. Selbst die besondere Empfindlichkeit ihres Körperchens zugegeben, sind wir doch ein Arbeitsvolk und auch Josefine gehört zu ihm; wenn wir aber wegen jeder Hautaufschürfung hinken wollten, dürfte das ganze Volk mit Hinken gar nicht aufhören. Nun, mag sie sich wie eine Lahme führen lassen, mag sie sich in diesem bedauernswürdigen Zustand öfters zeigen als sonst, das Volk hört ihren Gesang dankbar und entzückt wie früher, aber wegen der Kürzung macht es nicht viel Aufhebens.
Da sie nicht immerfort hinken kann, erfindet sie etwas anderes, sie schützt Müdigkeit vor, Mißstimmung, Schwäche. Wir haben nun außer dem Koncert auch noch ein Schauspiel. Wir sehen an belebten Orten hinter Josefine ihren Anhang, der sie bittet und beschwört zu singen. Sie wollte gern, aber sie kann nicht. Man tröstet sie, umschmeichelt sie, trägt sie fast auf den schon vorher ausgesuchten Platz, wo sie singen soll. Endlich gibt sie mit undeutbaren Tränen nach, aber wie sie mit offenbar bestem Willen zu singen anfangen will, matt, die Arme nicht wie sonst ausgebreitet, sondern vorn am Körper leblos hinunterhängend, wobei man den Eindruck erhält, daß sie vielleicht ein wenig zu kurz sind – wie sie so anstimmen will, nun, da geht es doch wieder nicht, ein unwilliger Ruck des Kopfes zeigt es an, im letzten Augenblick sinkt sie vor unsern Augen zusammen. Im allerletzten Augenblick allerdings rafft sie sich doch wieder auf und singt, ich glaube nicht viel anders als sonst, vielleicht, wenn man für feinste Nuancen das Ohr hat hört man ein wenig Erregung heraus, die der Sache nur zu Gute kommt. Und am Ende ist sie sogar viel weniger müde als vorher, mit festem Gang, soweit man ihr huschendes Trippeln so nennen kann, entfernt sie sich, jede Hilfe des Anhangs ablehnend, mit kalten Blicken die ihr ehrfurchtsvoll ausweichende Menge prüfend.
So war es letzthin, das Neueste aber ist, daß sie zu einer Zeit, wo ihr Gesang erwartet wurde gänzlich verschwunden war. Nicht nur der Anhang sucht sie, viele stellen sich in den Dienst des Suchens, es ist vergeblich, Josefine ist verschwunden, sie will nicht singen, sie will nicht einmal darum gebeten werden, sie hat uns diesmal völlig verlassen. Sonderbar wie falsch sie rechnet, die Kluge, so falsch, daß man glauben sollte, sie rechne gar nicht, sondern werde nur weiter getrieben von ihrem Schicksal, das in unserer Welt nur ein sehr trauriges sein kann. Selbst entzieht sie sich dem Gesang, selbst zerstört sie die Macht, die sie über die Gemüter erworben hat. Wie konnte sie nur diese Macht erwerben, da sie diese Gemüter so wenig kennt. Sie versteckt sich und singt nicht, aber das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung, fast ein wenig herrisch, eine in sich ruhende Masse, die förmlich, auch wenn der Anschein dagegen spricht, nur Geschenke geben, niemals empfangen kann, auch von Josefine nicht, dieses Volk zieht weiter seines Weges.
Mit Josefine aber muß es abwärts gehn und ich sehe schon die Zeit kommen, wo ihr letzter Pfiff ertönt und verstummt. Sie ist eine kleine Episode in der ewigen Geschichte unseres Volkes und das Volk wird den Verlust überwinden. Leicht wird es uns nicht werden, wie werden die Versammlungen in völliger Stummheit möglich sein. Freilich, waren sie nicht auch mit Josefine stumm, war ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lauter und lebendiger, als die Erinnerung daran sein wird, war es denn noch bei ihren Lebzeiten mehr als eine bloße Erinnerung, hat nicht vielmehr das Volk in seiner Weisheit Josefinens Gesang ebendeshalb, weil er in dieser Art unverlierbar war, so hoch gestellt? Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel entbehren, Josefine aber, erlöst von der irdischen Plage, die allen Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes, und bald, da wir keine Geschichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie alle ihre Brüder.

